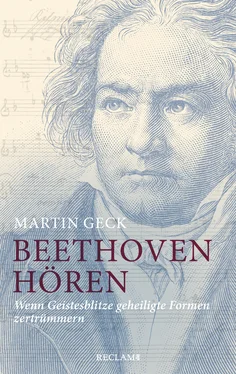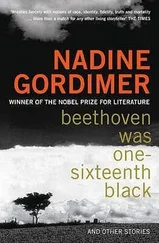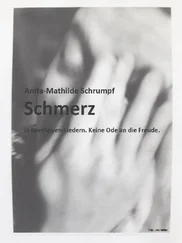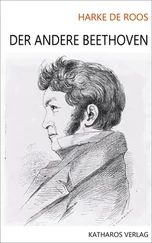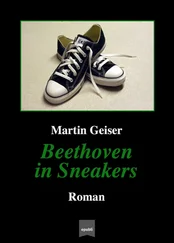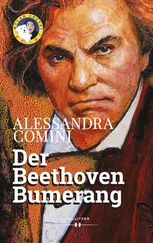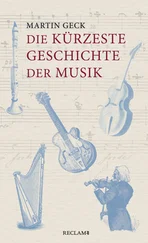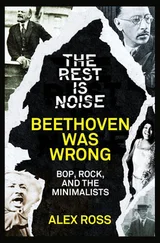Über Rousseau hinaus könnte man an Goethes Verständnis von der ebenso produktiven wie unberechenbaren Kraft des Dämonischen denken. Das Dämonische ist für Goethe ein gesetzmäßig nicht zu erfassendes Seinsmoment, nämlich »eine der moralischen Weltordnung wo nicht entgegengesetzte, doch sie durchkreuzende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte gelten lassen«.19 Ein Vergleich aus der Webersprache, der sich mit der nötigen Phantasie auf die Situation im ersten Satz der Sturm -Sonate anwenden lässt: Dem »Zettel« – also dem längs in den Rahmen eingespannten Garn – entspricht das Schema des Sonatensatzes; die »Einschlag« genannten Querfäden stehen für die spontanen körpersprachlichen Impulse.20
Letztlich hinkt der Vergleich; denn das Notenbild von Beethovens Sonate erinnert an alles andere als an eine schlichte Webarbeit: Sie gleicht vielmehr einer aufwendigen Textur, deren Kompliziertheit einem Hörer, der vor allem auf die narrativen Züge der Musik, also auch auf den »Einschlag« achtet, freilich gar nicht bewusst wird. Doch so aufwendig die kompositorische Textur auch ist: Vor allem hinsichtlich der oben diskutierten Momente – Satzeröffnung und Rezitativeinschübe – ist ein Sich-zu-erkennen-Geben des kompositorischen Ichs festzustellen, das die Struktur des Sonatensatzes nicht nur formal, sondern auch gestisch angreift. Die herausragenden Ereignisse des Satzes sind diejenigen Elemente, die sich nicht oder nur schwer ins übliche Schema integrieren lassen. Und eben das ist der »neue Weg«: seine Ichheit akzentuiert gegen die Konvention durchsetzen. Und das Geniale an dem Satz ist, dass Beethoven diese Konvention nicht etwa ignoriert, sondern das Thema ›Ichheit heraustreiben versus Regeln befolgen‹ geradezu auskomponiert: Er macht die Norm sichtbar und unterläuft sie zugleich. Das hat kein anderer Komponist auch nur annähernd so überzeugend geschafft. Man ist an Tischsitten erinnert: Nur wenn die anderen manierlich speisen, fällt es auf, dass einer aus dem Rahmen fällt.
Epiphanie: Das e-Moll-Thema im 1. Satz der Eroica
Genauso wenig, wie es bei der Betrachtung der Sturm -Sonate um den Sturm ging, soll es sich im folgenden um das Thema »Napoleon« drehen, obwohl solches in anderem Zusammenhang seinen guten Sinne hätte. Ich führe stattdessen das Thema »Die Ichheit in der Musik heraustreiben« weiter. Mein Ausgangspunkt ist eine Äußerung des zu seiner Zeit angesehenen Musiktheoretikers August Halm, der auf die zitierte programmatische Deutung der Sturm -Sonate durch Paul Bekker mit der polemischen Frage reagierte:
Kann mir jemand sagen, wieso ein C-dur, und käme es noch so überraschend, den Ernst der Lage oder der Mahnung erhöht? Will man schon ein Gleichnis, so werfe man es nicht mit dem Sachlichen durcheinander. Ich bitte: ein Gespenst mit einer C-dur-Wendung!21
Derselbe Halm, der mit seinen Musikanalysen unbedingt bei der Sache bleiben will, nennt zur Zeit dieser Veröffentlichung in anderem Kontext das e-Moll-Thema aus dem 1. Satz der Eroica unverhohlen einen »Fremdkörper«. Zwar hält er seine Bemühungen, motivische Zusammenhänge zwischen diesem Thema und dem Hauptthema festzustellen, für erfolgreich genug, um von nichts anderem als einer »neuen und unerwarteten Erscheinung« ebendieses Thema sprechen und den Begriff »neues Thema« somit gar nicht in den Mund nehmen zu müssen. Doch trotz alledem »stört« ihn die e-Moll-Passage selbst nach wiederholtem Spielen und Hören: Der Eindruck »von etwas irgendwie Schadhaftem« will nicht weichen, »die Form […] ist nicht ganz in Ordnung«.22 Mit leichtem Schmunzeln registriert man, dass Halm dieses Statement ausgerechnet unter der Überschrift »Über den Wert musikalischer Analysen« abgibt; und man darf vermuten, dass heutige Analytiker sich kaum ähnlich respektlos über den Komponisten Beethoven äußern würden.

Gleichwohl sind sie deshalb nicht aus der Bredouille. So hat der Autor des Eroica -Kapitels im 2009 erschienenen Beethoven-Handbuch einige Mühe, das Erscheinen des e-Moll-Themas als schlüssige Konsequenz eines übergeordneten »Gestaltungsprozesses« nachzuweisen. Vorsichtshalber vermeidet er den Begriff »Thema«, um stattdessen von einer »lyrischen Zone« mit einer neuen »Motivgestalt« zu sprechen.23 Und in der Tat gelingt es Konrad Küster plausibler als einst August Halm, diesbezügliche Zusammenhänge darzustellen. Das ist im Blick auf Beethovens musikdenkerische Potenzen nicht verwunderlich; auch muss es die nachschöpferische Leistung des Analytikers nicht schmälern, dass man vieles so, aber auch anders deuten kann. Unfassbar ist für mich jedoch, dass bei all dem Begriffsgeschiebe das Momentum, das die e-Moll-Szene darstellt, vollkommen aus dem Blick gerät.
Keine Hörerin, kein Hörer muss sich bei dieser Stelle etwas denken; unser Unbewusstes mag mit ihrem emotionalen Gehalt auch ohne intellektuelle Reflexion klarkommen. Doch wenn man schon über diese Stelle reflektiert, so wäre es unangemessen, sich ihr lediglich mit taktischem Wissen nähern zu wollen, anstatt ihre Funktion im Satzganzen auch von der emotionalen Seite her zu betrachten. Hier soll das unter dem Aspekt der »Epiphanie« geschehen. Umberto Eco hat als Beispiel für »Epiphanie« auf eine Szene aus James Joyce’ Ein Porträt des Künstlers als junger Man n verwiesen, in der sich Stephen mit einem Daedalus identifiziert, der falkengleich über den See der Sonne entgegenfliegt: »Die sinnliche Assoziation, zunächst durch die Stimme, die von ›jenseits der Welt‹ zu kommen scheint, gegeben, ereignet sich in einer ›zeitlosen‹ Zeit.«24
Mit der Vorstellung einer »Stimme, die von ›jenseits der Welt‹ zu kommen scheint«, sind wir bei dem e-Moll-Thema der Eroica . Nach Ausweis der Skizzen zählte dieses zu den frühen Einfällen Beethovens, der den Kopfsatz der Eroica womöglich – zugespitzt und hypothetisch formuliert – auf dieses Ereignis hin konzipieren wollte. Es ist zweitrangig, ob man das Thema mit der »innerlich vernommenen höheren Stimme« identifiziert, von der das potenzielle Libretto zu dem von Beethoven vertonten Ballett Die Geschöpfe des Prometheus spricht, ob man die Eroica somit als Prometheus-Sinfonie deutet. Wesentlich ist vielmehr, dass man überhaupt vom Auftritt einer Stimme spricht, die das Continuum der Erzählzeit aufsprengt. Diese Stimme ist den oben beschriebenen Rezitativen aus der Sturm -Sonate vergleichbar – mit dem Unterschied – dass es sich im Fall der Eroica um die Stimme der Oboe handelt, die man seit jeher dem Orgelregister vox humana zugeordnet hat (dazu mehr im folgenden Abschnitt über die Fünfte ). Und dass es sich diesmal nicht um einen Ausdruck der Klage, sondern um den des Trostes oder des Zuspruchs handelt.
Um August Halms Metapher vom »Fremdkörper« aufzugreifen: Handelt es sich womöglich um einen »Fremdkörper« ganz anderer Art, nämlich um die Stimme aus einer anderen Welt?
Wolfgang Robert Griepenkerl schildert in seiner Novelle Das Musikfest oder die Beethovener von 1838 eine Probe des 1. Satzes der Eroica , in der sich die Musik für die anwesenden Hörer als nicht beherrschbar erweist. Kurz vor dem Eintritt des e-Moll-Themas (T. 248 ff.) ziehen die tiefen Streicher unter Führung des Kontrabassisten Hitzig
von ihrer A Saite ein so ungeheures H herunter, während die zweiten Geigen mit der None trotzten, daß das ganze Auditorium mitten hinein in diesen Riß durch die Rechnung eines Jahrhunderts ein brausendes Hurrah schrie […] dies war Pindar, der dithyrambisch stürmende Pindar des neunzehnten Jahrhunderts.25
Читать дальше