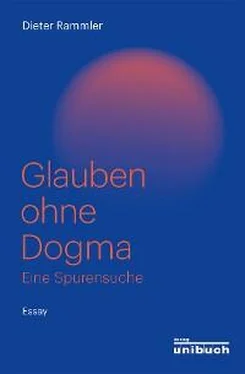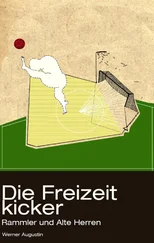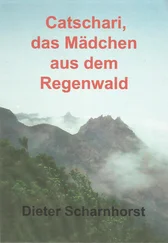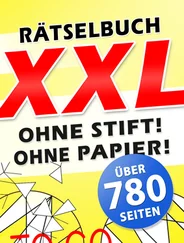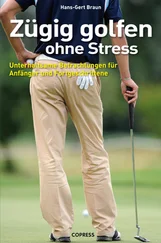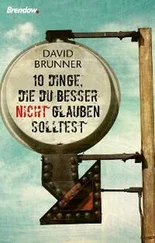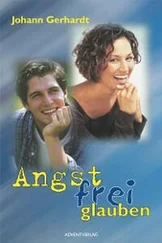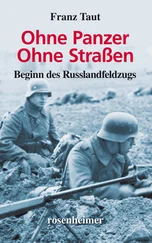Die Bibel nicht den modernen Fundamentalisten zu überlassen, bleibt eine Herausforderung. Das kann gelingen, wenn wir sie als eine Bibliothek und Meistererzählung des Glaubens verstehen, als Literatur gewordene Erfahrungen, die zum Anstoß neuer Erfahrungen werden können. Grundwissen über die Bibel zu vermitteln, ist auch eine kulturelle Bildungsaufgabe. Wer die Bibel nicht kennt, dem fehlen schlicht Schlüssel zum Verständnis nicht allein der europäischen Kultur. Die biblischen Symbole prägen Werte und Kultur eines Großteils der Menschheit.
Als Christen sollten wir respektvoll mit den religiösen Überlieferungen anderer Religionen umgehen. Dazu gehört, dass wir uns ausreichend über sie informieren; noch besser wäre es, sie in ihren Grundzügen zu kennen. In diesem Zusammenhang zählt zu den besonderen Leistungen der modernen Bibelwissenschaft, dass sie den eigenständigen Charakter des jüdischen Tanach wiedererkannt hat und seine christliche Gleichsetzung mit dem Alten Testament kritisch hinterfragt. Die alternativen Redeweisen vom Ersten Testament oder von der Hebräischen Bibel haben hier ihren Ursprung. Deshalb muss man nicht auf die christliche Lesart verzichten. Zu glauben, dass sich in der Geschichte Jesu Christi zentrale Hoffnungen der Propheten Israels bewahrheiten, ist nicht antijudaistisch. Fatal wäre es allerdings, wenn diese Sichtweise mit einer Abwertung der jüdischen Lesart verbunden wäre. Es gehört zu den fundamentalen Einsichten der heutigen Theologie, dass das Christentum im Glaubenshorizont des Judentums nicht nur entstanden ist, sondern bei allen Unterschieden auf diesen angewiesen bleibt. Gott sei Dank gehören die meisten christlichen Kirchen heute, von Ausnahmen abgesehen, zu den klaren Gegnern des Antisemitismus – was angesichts der langen und unheilvollen Geschichte des christlichen Antijudaismus und Antisemitismus allerdings nur sehr demütig festgestellt werden sollte.
Eine ähnliche Annäherung sollten wir zu aufgeklärten islamischen Theologen und Theologinnen suchen. Es ist sehr aufschlussreich, in wie vielfältiger Weise man sich in den großen gebildeten Schulen des Islam auf zentrale Traditionen bezieht, die wir auch aus den antiken Schriften des Judentums und des Christentums kennen, zum Beispiel, dass Islam Barmherzigkeit ist (Mouhanad Khorchide). Aus der Sackgasse falscher Überlegenheitsgefühle führen nur der wechselseitige Respekt und das ehrliche Bemühen, mehr über den anderen zu erfahren.
Jesus stammte aus Nazareth, einem kleinen Ort in Galiläa. Maria und Josef waren seine Eltern. Er hatte Geschwister, von denen ihm Jakobus besonders nahestand. Er wurde ein charismatischer Wanderprediger, der eine religiöse Gruppe von Frauen und Männern anführte und als deren Kopf sowohl der Gotteslästerung als auch des Hochverrats angeklagt, verurteilt und hingerichtet wurde.
Als junger Mann war er mit Johannes dem Täufer am Rande der judäischen Wüste in Kontakt getreten, teilte dessen Idee der Gotteswirklichkeit und ließ sich von ihm zum Zeichen der Buße und Umkehr taufen. Schließlich trennte er sich von Johannes, um seiner eigenen Berufung zur Verkündigung des Reiches Gottes zu folgen. Damit begann er in seiner Heimat Nazareth im galiläischen Bergland und in Kapernaum am See Genezareth, wo er allerdings bis in seine Familie hinein auf Unverständnis und Ablehnung stieß. Jesus forderte von seiner kleinen Anhängerschaft, dass sie sich ebenfalls von ihren Herkunftsfamilien trennte und ausschließlich der Verbreitung der messianischen Botschaft verschrieb. Besonders umstritten war er bei einem Teil der pharisäischen Reformbewegung, an deren aus seiner Sicht rechthaberischer und selbstgerechter Frömmigkeit sich wiederholt Konflikte entzündeten. Teile der Rabbinen und Pharisäer lehnten seinen Auslegungsanspruch ab und attackierten öffentlich seinen Umgang mit fragwürdigen Leuten als anmaßend und gotteslästerlich. Tatsächlich scheute er nicht den Kontakt in soziale Milieus, um die man einen großen Bogen machte: Prostituierte und Zöllner zum Beispiel, die man als römische Kollaborateure verachtete. Wohin Jesus von Nazareth kam, sammelten sich kranke Menschen um ihn in der Erwartung einer heilsamen Berührung und Ermutigung zum Leben. Von seinem Glauben an die alles erfüllende Gotteswirklichkeit erzählte er sehr lebensnah vor allem in seinen Gleichnissen. Er nahm die Menschen mit. So wuchs die Bewunderung, und wohin er kam, zog er viele an. Manche sahen in ihm einen zweiten Johannes (der Täufer Johannes war hingerichtet worden), obwohl er nicht taufte, andere sogar den wiedererstandenen Propheten Elia. In seiner Auslegung der Tora suchte er, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und den Sinn und Zweck der Gebote herauszustellen. Bloßen Ritualismus nahm er nicht ernst, und eine zur Schau gestellte Frömmigkeit verabscheute er. Er vertrat eine pazifistische Ethik und setzte sich mit dem Tempelkultus sehr kritisch auseinander. Diese Haltung weckte Widerspruch und führte zu Nachstellungen. Als er die Geschäftetreiberei im Tempelbezirk angriff und Jerusalems Schicksal prophetisch ankündigte, geriet er mit den Jerusalemer Autoritäten der Priesteraristokratie in Konflikt. Sie ließen ihn am Abend des Passahfestes festnehmen, der Gotteslästerung anklagen und den römischen Besatzern zur Verurteilung übergeben. Es folgte ein politisches Urteil, weil er angeblich von sich behauptet hatte, König der Juden zu sein, also einen messianisch-politischen Anspruch erhoben hätte. Jesus von Nazareth wird gefoltert, öffentlich gedemütigt und gekreuzigt und stirbt auf der Richtstätte Golgatha in Jerusalem. Seine Anhänger dürfen ihn begraben. Die Frauen unter ihnen suchen nach seinem Tod das Grab auf und erzählen erschüttert, dass sie ihn nicht unter den Toten gefunden hätten. Sie wären einem Engel begegnet, der seine Auferweckung verkündigt hätte.
Ein jüdischer Mann fühlte sich berufen, seinen Glauben an Gott, wie er in der Tora bezeugt ist, eigenständig auszulegen. Im Glauben, dass Gottes Eingreifen sich sogar schon andeutet, wollte er Menschen aufwecken und überzeugen, dass etwas Umwälzendes geschieht und sie im Hochgefühl einer Zeitenwende, eines Kairos, zu einem Sinnes- und neuen Lebenswandel anhalten. Seine Anhänger bildeten mit ihm eine Nachfolgegemeinschaft, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützte. Er fühlte sich seinem Gott auf innigste Weise nahe und schöpfte daraus Kraft und Entschlossenheit, sah sich als Werkzeug Gottes, als Bote seiner Gerechtigkeit. Gebildet und mit den religiösen Überlieferungen seines Volkes vertraut, zitierte er nach altem Brauch die Tora in der Synagoge und legte sie aus, wurde dort aber mit seiner eigenwilligen Lesart und Interpretation abgelehnt und vollzog dann selbst den Bruch mit seinem bisherigen Leben.
Ich denke, dass er sich als messianischen Propheten und Friedensboten betrachtete. Er war sich seiner Berufung gewiss. Es scheint andererseits aber so gewesen zu sein, dass er immer wieder hinter seiner Botschaft und hinter seinem Wirken zurücktrat und weder sich selbst noch einen seiner Anhänger hervorheben wollte, und er wollte, dass das in seinem Umfeld auch kein anderer tat.
Ich glaube nicht, dass die Gottessohnschaft zu seinem Selbstverständnis gehörte, wie es die Evangelien retrospektiv darstellen. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes sei, ist Ausdruck des Glaubens seiner Nachfolger und Nachfolgerinnen. Wohl aber glaube ich, dass er, wie schon der Täufer, nur wesentlich hoffnungsvoller als dieser, sich als ein Bote einer großen Zeitenwende gesehen hat. Dass er sich berufen glaubte, den Menschen Augen und Herzen für die Wirklichkeit Gottes zu öffnen, mit der Vision von einer Welt, in der das Böse entmachtet ist (Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, Lukas 10), wo Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich küssen, Lahme gehen, Blinde sehen und den Armen das Reich Gottes verkündigt wird, wie es bei den Propheten immer wieder angeklungen ist. Und das in einer Zeit, die alles andere als friedlich war. In jedem Dorf und jeder Stadt lehrten römische Garnisonen das Fürchten. Die politische Führung war korrupt und konnte sich nur als Vasall Roms behaupten. Großgrundbesitzer hatten weite Teile des Landes in ihren Besitz gebracht und nahmen die Landlosen aus. Neben großer Armut wuchsen römische Villen und Latifundien für die Schönen und Reichen am See Genezareth und an der Levante. Und im Untergrund sammelten sich jüdische Aufständische.
Читать дальше