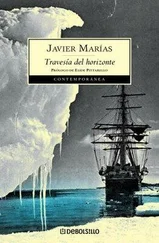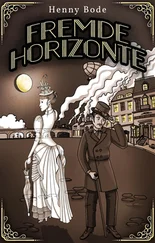Seine Singstimme klingt höher als seine Sprechstimme. Ich versuche, mich genau an den Klang seiner Stimme zu erinnern, an den Klang unseres Gesprächs am Samstagmorgen. Er singt auf Französisch, aber gesprochen haben wir deutsch. Sein Deutsch ist nahezu perfekt, nur ab und zu spitzt er die Vokale kaum merklich an. Er sei praktisch bei seiner Großmutter aufgewachsen, ihre elsässische Mundart sei seine erste Sprache, erzählte er mir. In welcher Sprache er wohl träumt? Nach ein paar Wochen in Bath damals begann ich auf Englisch zu träumen. Noch seltsamer aber war, dass ich, wenn ich mit meinen Eltern in Deutschland telefonierte, nur noch den Dialekt herausbrachte, den ich seit vielen Jahren nicht mehr gesprochen hatte. Es scheint, als gäbe es eine unterste Sprachschicht, eine Art Sprache im Rückenmark, die dann zum Tragen kommt, wenn alle höheren Kontrollinstanzen versagen. Fliehen oder bleiben? Fangen oder gefangen werden? Ich frage mich, ob die Sprache, die ihm am nächsten ist, nicht die Mundart seiner Großmutter sein müsste und ob sich seine französischen Liebeslieder für ihn nicht falsch anfühlen, wenn er sie singt. Aber vielleicht hilft ihm gerade das bei der Trennung des Persönlichen vom Biografischen, auf die er so vehement besteht.
Es ist ein komisches Spiel, das die Künstler treiben! Sie geben sich ganz in ihre Kunst, und hinterher behaupten sie, dass das alles nichts mit ihrem Leben zu tun habe. Abgesehen vielleicht von ein paar Verrückten, die keine Angst davor haben, Freunde und Familie zu verletzen und zu verlieren und die ganze Welt vor den Kopf zu stoßen.
Ich habe ihn mir oft vorgestellt, diesen Moment, als Thomas Mann in seinem Gartenstuhl in Pacific Palisades den Kopf hob und in die schweigenden Gesichter seiner Familie sah. Wie er auf dem sonnigen Rasen sitzt, im weißen Anzug, mit übereinandergeschlagenen Beinen, auf dem Schoß das Manuskript. Michaels gesenkter Kopf, die Hände in die Armlehnen gekrallt, zum Sprung bereit, und Katja mit der Empörung der Großmutter in den Augen, und dieses fassungslose Schweigen in der Luft, die Fassungslosigkeit darüber, dass er es getan hat, dass er seinen Enkel, seinen geliebten Enkel, sein Engelskind, an einer Hirnhautentzündung hat sterben, nein, nicht nur sterben, sondern qualvoll zugrunde gehen lassen. Ja, Echo war eine literarische Figur. Aber eben nicht nur. Der Schriftsteller hatte sich Michaels Sohn vorgenommen und war diesem Gefühl nachgegangen, dem Gefühl, zu dem er Zugang brauchte für seinen Leverkühn, dem Gefühl des schlimmsten Verlustes. Rücksichtslos, man muss es sagen, ohne Rücksicht auf irgendjemanden, auch nicht auf sich selbst. Wie lautet des Teufels Bedingung für wahre Kunst? Du darfst nicht lieben! Ganz schön pathetisch. Und wenn es stimmt?
Ich habe das Album in einem Rutsch durchgehört. Jetzt kann ich ihn schon nicht mehr so gut leiden. Zum Glück. Und doch spüre ich Panik aufsteigen, dass alles so unversehens endet, wie es angefangen hat, und ich dann wieder dem ewig gleichen Alltag ausgeliefert sein werde, der mich so unendlich müde macht.
Stéphane schreibt: Ich habe dein Buch gelesen. Aber ich habe dich nicht darin gefunden.
Ich schreibe: Warst es nicht du, der sagte, die Wirklichkeit hat in einer Geschichte nichts zu suchen?
Stéphane schreibt: Wahrheit und Wirklichkeit sind keine Synonyme. Du willst dich also nicht fangen lassen?
Ich schreibe: Was würdest du tun, wenn du mich fingest?
Stéphane schreibt: Wenn ich dich fangen würde, müsste ich dich wohl festhalten, damit du mir nicht wieder entkommst. Und dann würde ich versuchen, dich zu küssen. Et puis …?
Ich muss Theresa anrufen. Ich suche nach dem Telefon, verräume die Wäsche im Kinderzimmer, setze mich aufs Bett meines Sohnes und drücke die Kurzwahltaste. Wir sehen uns selten, meistens bleibt es bei Absichtsbeteuerungen, weil wieder was dazwischengekommen ist, krankes Kind, kranker Mann, Arbeit, Urlaub. Aber schlimm ist das nicht. Wir können, ohne uns zu treffen oder ständig zu telefonieren, jederzeit dort anknüpfen, wo wir immer waren. Anders als ich, ist sie nach dem Studium von einer Stadt in die nächste gezogen und schließlich in Offenburg gelandet. Als sie hört, wie meine Stimme am Telefon klingt, sagt sie nur: Komm! Komm sofort! Also fahre ich am Freitag zu Theresa und werde ihr erzählen und die Ohren vollheulen.
Wir kennen uns seit über dreißig Jahren. In der achten Klasse waren wir in denselben Jungen verschossen. Er war süß und ein völliger Idiot. Am Ende ist er mit einer Dritten davongezogen. Danach begann, was wir für unsere wilden Jahre hielten. Mit roten Ohren umpflügten wir das Schulhaus in der großen Pause und drehten die Köpfe nach den Oberstuflern. Friedrich wollte ich unbedingt. Ich war nicht besonders verliebt, aber ich wollte ihn unbedingt. Es war auf der Studienfahrt nach Rom, und wir waren siebzehn, bald achtzehn. Wir fuhren zusammen mit der Parallelklasse aus dem altsprachlichen Zug. Es waren nur etwa zehn Schülerinnen und Schüler, lauter Bildungsbürgerkinder, darunter Friedrich und Marcus. Und am Ende der Woche knutschte Theresa mit Marcus und ich mit Friedrich.
Wie konnte man nur siebzehn sein und Friedrich heißen? In den Achtzigerjahren. Er kam aus einer anderen Welt. Sein Vater stammte aus einer Frankfurter Professorenfamilie, war Mediziner und wohnte als Privatdozent drei Tage die Woche getrennt von seiner Familie in Stuttgart. Seine Mutter war Malerin. Das Haus in bester Hanglage der kleinen Stadt, in der wir zur Schule gingen, war voller Kunst und Bücher, und der Bechstein-Flügel im Wohnzimmer war kein Ausstellungsstück, sondern das Trainingsgerät des musikalisch hochbegabten älteren Bruders. Friedrich hatte Geigenunterricht, Leichtathletiktraining, Tennisstunden und war Ministrant im Münster.
Besonders quälte mich die Vorstellung vom Leichtathletiktraining, wo er zweimal in der Woche auf das Mädchen traf, von dem er sich nach der Studienfahrt getrennt hatte. Ganze zehn Tage hatte er dafür gebraucht. In der ersten Zeit sahen wir uns außerhalb der Schule praktisch nie. Direkt nach dem Unterricht wurde er mit seinem Bruder von der Mutter im Auto abgeholt. Und ich schlug mich mit der Frage herum, warum er vor ihr verheimlichte, dass er eine neue Freundin hatte.
Friedrich war riesig, und es genügte nicht, mich auf die Zehenspitzen zu stellen, wenn ich ihn küssen wollte. Im Grunde küsste immer nur er mich, von oben herab. In der großen Pause gingen wir Hand in Hand zu einer der Bänke im hinteren Bereich des Schulareals. Auf seinem Schoß sitzend war ich auf Augenhöhe mit ihm. Seine Küsse fand ich nie besonders aufregend, aber wenn niemand in der Nähe war, schob er seine Hand unter mein Oberteil und streichelte meine Brüste. Konzentriert, mit offenen Augen, die ins Unendliche blickten, liefen seine Finger ihre Form ab, von außen nach innen, immer und immer wieder.
Ich glaube, es dauerte ein halbes Jahr, bis ich zum ersten Mal bei Friedrich zu Hause war. Obwohl sie eine große Villa hatten, musste er sich das Zimmer mit seinem Bruder teilen, der jedes Recht hatte, hereinzuplatzen, wann immer es ihm einfiel. Zum Glück befand sich der Flügel zwei Halbgeschosse vom Zimmer der Brüder entfernt, sodass meist genügend Zeit blieb zwischen dem Verstummen der Musik und dem Öffnen der Tür.
Als wir den Führerschein hatten, fingen wir an, uns mit den Zweitwagen der Mütter regelmäßig zu besuchen. Das war im Herbst neunundachtzig, und in Berlin überschlugen sich die Ereignisse. Seit Jahrzehnten war im Westen klar, was im Fall des Mauerfalls zu denken und zu fühlen sei. Ohne kollektiven Freudentaumel in ganz Deutschland würde es nicht gehen, mit abnehmender Intensität von Nordosten nach Südwesten. Während sich in Berlin wildfremde Menschen um den Hals fielen, saßen Friedrich und ich am entgegengesetzten Ende des Landes unter einer Autobahnbrücke, das Autoradio aus, die Scheiben des Wagens beschlagen, seine Hand unter meinem Pulli, meine Hand in seiner Hose. Weiter weg vom Weltgeschehen konnte man nicht sein, und in meinem Kopf kreiste die Frage, was er wohl empfand und was ich wohl empfinden sollte.
Читать дальше