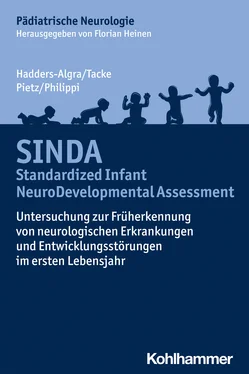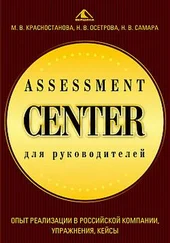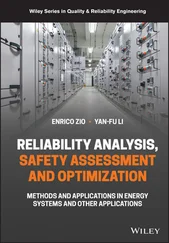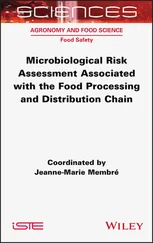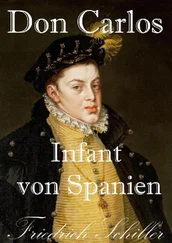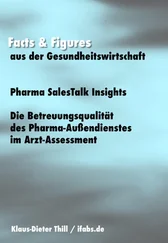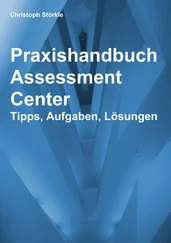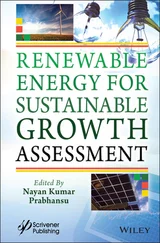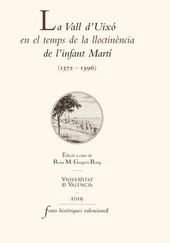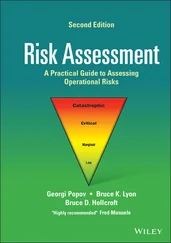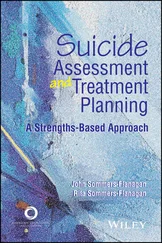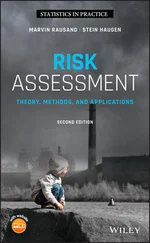Video 5.81: Exploriert Objekt beim Betrachten mit den Fingerspitzen (Item 85)
Video 5.82: Legt Objekt in einen Becher (Item 86)
Video 5.83: Sitzt anhaltend frei (Item 87)
Video 5.84: Sitzt frei und dreht Oberkörper (Item 88)
Video 5.85: Kniestand und hält sich dabei an Möbeln fest (Item 89)
Video 5.86: Fortbewegung auf allen Vieren, Hüpfen, Poporutschen (Item 90)
Video 5.87: Imitiert Backe-Backe-Kuchen oder andere Fingerspiele (Item 91 )
Video 5.88: Variiert Mimik, Gestik in Reaktion auf vertraute und fremde Personen (Item 92 )
Video 5.89: Reagiert auf die Frage: »Wo ist …?« (Person, Objekt) (Item 93 )
Video 5.90: Bildet mindestens zwei verschiedene verbundene Drei-Silbenketten (Item 94)
Video 5.91: Schaut Bilder im Buch an und blättert um (Item 95)
Video 5.92: Gemeinsame Exploration (joint attention) (Item 96 )
Video 5.93: Nutzt den Zeigefinger zum Berühren von Details eines Objekts (Item 97)
Video 5.94: Setzt sich selbständig hin (Item 98)
Video 5.95: Zieht sich zum Stehen hoch (Item 99)
Video 5.96: Findet Objekt unter einem Becher (Item 100)
Video 5.97: Hält zwei Objekte und ergreift ein drittes (Item 101)
Video 5.98: Benutzt Löffel zum Rühren in Becher, auf Teller (Imitation) (Item 102)
Video 5.99: Zieht an der richtigen Schnur Objekt heran (Item 103)
Video 5.100: Macht einige Schritte seitwärts an Möbeln (Item 104)
Video 5.101: Auf Aufforderung werden semantische Gesten gezeigt (Item 105 )
Video 5.102: Verwendet »Mama« oder »Papa« oder anderes Wort begrifflich (Item 106 )
Video 5.103: Findet Objekt unter einem von zwei Bechern (Item 107)
Video 5.104: Deutet mit Zeigefinger auf Person oder Objekt (Item 108 )
Video 5.105: Benutzt Pinzettengriff (Item 109)
Video 5.106: Wirft kleinen Ball nach vorn (Item 110)
Video 5.107: Steht für mindestens drei Sekunden frei (Item 111)
Video 5.108: Geht einige Schritte an einer Hand gehalten (Item 112)
Video 5.109: Geht in die Hocke mit Festhalten (Item 113)
Video 6.1: Typische und atypische Emotionalität
Video 6.2: Typische und atypische Selbstregulation
Video 6.3: Typische und atypische Reaktivität
Die Arbeit, die wir in diesem Buch beschreiben, ist das Ergebnis von Zusammenarbeit und Beiträgen vieler Personen. Wir danken Herrn Professor Dr. med. Prof h.c. (UCM) Florian Heinen aus München für seinen Enthusiasmus und die Unterstützung bei der Durchführung und Fertigstellung von SINDA. Wir danken auch dem interdisziplinären Team am SPZ Frankfurt-Mitte (Deutschland) für das anhaltende Interesse an SINDA und die Energie bei der Datenerhebung unserer klinischen Kollektive. Unser Dank gilt auch dem Team der Physiotherapie am Universitäts-Kinderspital in Basel (Schweiz) für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung in unserem SINDA Projekt. Wir sind besonders dankbar für die glänzende und kompetente Unterstützung von Anneke Kracht, die alle Abbildungen und Videoclips aufbereitet hat. Wir möchten auch Dr. André Rupp für seine hervorragende statistische Unterstützung aufrichtig danken. Wir danken Donna Tennigkeit (Medizinstudentin) für die Eingabe der klinischen Daten in die Datenbanken.
Die Erhebung der niederländischen Normdaten wäre nicht möglich gewesen ohne die Beiträge der Kolleginnen der KinderAcademie in Groningen (Niederlanden; Leitung der KinderAcademie: Selma de Ruiter, PhD, und Francien Geerds, MSc), der vielen Masterstudierenden der Medizin der Universität von Groningen, der Kinderphysiotherapeutinnen Ying-Chin Wu, PhD, und Patricia van Iersel, PhD, und der Kinderneurologin Kirsten R. Heineman, PhD. Nicht zuletzt danken wir den vielen Eltern und Säuglingen, die an den Untersuchungen, die diesem SINDA-Manual zugrunde liegen, teilgenommen haben, insbesondere denen, die es uns erlaubt haben, Fotos und/oder Videoaufnahmen ihrer Säuglinge als Bildmaterial für SINDA zu verwenden.
Die Erhebung der Normdaten war Teil des IMP-SINDA-Projekts, das von der Cornelia Stiftung und der Stiftung Entwicklungsneurophysiologie Groningen finanziell unterstützt wurde. Schließlich danken wir Linze Dijkstra für die technische Unterstützung beim IMP-SINDA-Projekt.
Mijna Hadders-Algra, Uta Tacke, Joachim Pietz und Heike Philippi
1 Einführung
1.1 Was ist SINDA – Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment?
Das Untersuchungsverfahren »Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment« ist eine klinische Screeningmethode zur Identifikation und Begleitung von Säuglingen, die ein hohes Risiko für entwicklungsneurologische Erkrankungen haben. Sie ist anwendbar für den Altersbereich von sechs Wochen bis zwölf Monaten »Korrigierten Alters (KA)«. SINDA richtet sich an medizinische Fachpersonen, die in der Frühdiagnostik von Entwicklungsstörungen und neurologischen Erkrankungen tätig sind, wie z. B. Kinder- und Jugendärzte, Entwicklungs-, Kinderneurologen, spezialisierte Physio-, Ergo- und Sprachtherapeuten. SINDA ermöglicht es den Fachpersonen, den aktuellen entwicklungsneurologischen Befund zu bestimmen und gibt Informationen zum Risiko des Kindes für spätere Entwicklungsstörungen und neurologische Erkrankungen wie Cerebralparese, Intelligenzminderung oder Verhaltensstörungen (Hadders-Algra et al. 2019, 2020).
SINDA besteht aus drei Skalen:
• Die Neurologische Skala besteht aus 28 Items, die für den gesamten Altersbereich von sechs Wochen bis zwölf Monaten KA gelten und in jedem Lebensalter identisch formuliert sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beurteilung der Qualität der spontanen Bewegungen. Die Durchführungszeit beträgt etwa zehn Minuten.
• Die Entwicklungs-Skala besteht aus 15 Items für das korrigierte Alter des jeweiligen Kindes; für den gesamten Altersbereich gibt es 113 Items. Sie umfassen die Bereiche Kognition, Kommunikation, Grob- und Feinmotorik. Die Durchführungszeit ist abhängig vom Alter des Säuglings; sie beträgt etwa 5–7 Minuten für die jüngste und 10–15 Minuten für die älteste Altersgruppe.
• Die Sozioemotionale Skala beurteilt vier Verhaltenskategorien: Interaktion, Emotionalität, Selbstregulation und Reaktivität. Die Items sind für den gesamten Altersbereich identisch. Sie werden während der Durchführung der Entwicklungs-Skala mitbeurteilt, sodass keine zusätzliche Zeit nötig ist.
SINDA kann in jeder (geeigneten) Umgebung durchgeführt werden. Man braucht nur einfache Materialien: eine Untersuchungsmatratze (-liege) und ein paar attraktive Objekte, die in jeder Spielzeugabteilung erhältlich sind, wie eine kleine Micky Maus Figur, eine Rassel und einen Ball.
SINDA wurde entwickelt, da es bislang kein kurzes und präzises Verfahren gab, das den neurologischen Status, den Entwicklungsstand und den sozioemotionalen Befund des Säuglings beurteilt. Es gibt zwar Verfahren, die jeweils einzelne Domänen berücksichtigen. So kann der neurologische Befund mit der Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE; Haataja et al. 1999; Romeo et al. 2016) und mit den Methoden nach Amiel-Tison (Amiel-Tison und Grenier 1986) und Touwen (Touwen 1976) beurteilt werden. HINE ist international weit verbreitet und schnell durchführbar. Allerdings berücksichtigt HINE kaum die spontanen Bewegungen, obwohl nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zustand des kindlichen Gehirns gerade über die Spontanmotorik erkannt werden kann. Aus diesem Grund hat die Qualität der Spontanmotorik in der Neurologischen Skala von SINDA einen zentralen Stellenwert. (HINE hat den Nachteil, dass die Risikoabschätzung altersabhängig ist und nicht für alle Altersgruppen im Säuglingsalter zur Verfügung steht.)
Zur Entwicklungsbeurteilung des Säuglings werden häufig die Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley 2006), die Griffiths Mental Development Scales (Green et al. 2015) und die Mullen Scales of Early Learning (Mullen 1995) durchgeführt. Diese Verfahren dienen der umfassenden – im Alltag oft delegierten – Entwicklungsbeurteilung, wohingegen es sich bei SINDA um ein Screeningverfahren handelt. Im Vergleich zu den genannten Tests gilt für SINDA:
Читать дальше