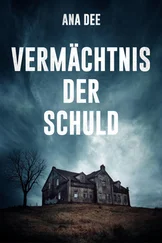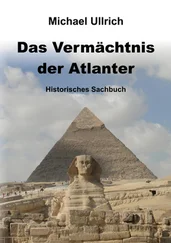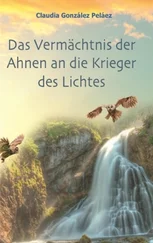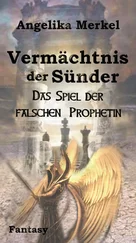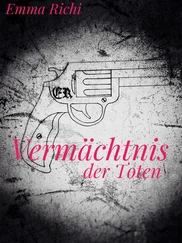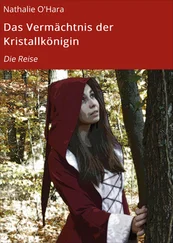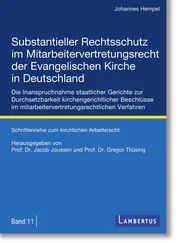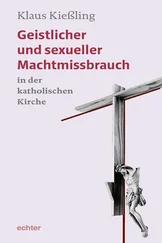Mainz, im Juli 2019 Matthias Pulte
Einleitung
Das kirchliche Vermögensrecht schien über viele Jahre nach der Neukodifikation des Rechts der katholischen Kirche eher eine Angelegenheit für einen überschaubareren Kreis von Experten und kirchlichen Vermögensverwaltern vor Ort zu sein. Es hat auch meist bei der Themenauswahl für die Veranstaltungen des Vollstudiums Theologie, geschweige denn des Studiums der Theologie in Mehr-Fach Kombinationen kaum Beachtung gefunden. Es ist wohl ein bleibender Verdienst der Ereignisse um die Finanzierung von Aus- und Umbau des Limburger Domberges nach der Jahrtausendwende, dass eine breitere Öffentlichkeit mehr über das kirchliche Vermögensrecht und die Transparenz in der kirchlichen Vermögensverwaltung erfahren wollte. Zudem sind heute die leitenden Pfarrer und auch andere Seelsorgerinnen und Seelsorger in immer größer werdenden pastoralen Räumen vor die Aufgabe gestellt, sich mit Fragen der Vermögensverwaltung zu beschäftigen, die in der akademischen und pastoralen Ausbildung bisher nicht so zentral gewesen sind.
Dieses Buch will den Leserinnen und Lesern einen Zugang zu einem oftmals unbekannten und weil so anders als die Theologie, so schwer verständlichen Rechtsgebiet verschaffen, in dem nicht nur das Recht der universalen Kirche, sondern auch das der Ortskirchen, der eigenberechtigten Rechtsträger und des Staates den rechtlichen Rahmen für die kirchliche Vermögensverwaltung abgeben.
Definition:
Das kirchliche Vermögensrecht umfasst alle Bestimmungen, die für das der Kirche eigene Vermögen in seinen rechtlichen Beziehungen maßgeblich sind. Diese Rechtsbeziehungen sind: Erwerb, Besitz, Verwaltung, Belastung und Veräußerung des Kirchenvermögens.
Eine Reform des kirchlichen Vermögensrechts ist schon lange vor dem 2. Vatikanischen Konzil aus Teilen der Weltkirche gefordert worden. Immer wieder wurde darauf abgestellt, dass das Recht des CIC/1917 das mittelalterliche Vermögensrecht insbesondere hinsichtlich des Benefizialwesens konserviere und dass eine Anpassung dieses Rechtsgebiets an die Rechtswirklichkeit moderner Wirtschafts- und Vermögensverwaltung anzupassen sei. 1Der kirchliche Gesetzgeber folgte nach dem Konzil diesen Desideraten. Die Relatio von 1982 zum Gesamtentwurf des CIC reflektiert diesen Diskussionsstand. 2Warum, so mag man im 21. Jahrhundert weiter fragen, braucht es überhaupt ein universalkirchliches Vermögensrecht, insbesondere wenn man bedenkt, dass die staatlichen Rechtsordnungen, mit denen die Kirche sich in vielen Bereichen zu arrangieren hat, weltweit doch höchst unterschiedlich und zugleich von einer erheblichen Veränderungsdynamik geprägt sind und zudem die Kirche in ihren Beziehungen zu den Staaten ganz unterschiedliche Rechtspositionen einnimmt? Sie reichen von einer weitgehenden Ignoranz der kirchlichen Sozialnatur in nationalen Rechtsordnungen bis zu einem fein abgestimmten Staat-Kirche Verhältnis in Deutschland. Eine erste Antwort ergibt sich aus der ekklesiologischen Konzeption der katholischen Kirche, wie sie das 2. Vatikanische Konzil formuliert hat. Die katholische Kirche als Universalkirche mit ihrer zentralen Organisation besteht in und aus Teilkirchen (LG 23, siehe auch c. 368). Dieses ineinander Verwobensein der beiden Strukturen erstreckt sich in rechtlicher Hinsicht auf alle Regelungsbereiche des kirchlichen Lebens. Der CIC von 1983 dekliniert diese Einheit in der Vielheit in all seinen Rechtsgebieten durch, nicht nur aber auch, um einheitliche strukturelle und rechtliche Standards in der weltweiten katholischen Kirche zu besitzen, die freilich nach der jeweiligen Notwendigkeit durch partikulares Recht ergänzt und bisweilen auch verändert werden. So zeigt sich im kirchlichen Vermögensrecht, das mit nur 57 (!) Canones eines der kleinsten Bücher des CIC ist, auf engem Raum die Dynamik und Flexibilität kirchlicher Gesetzgebung. Allerdings steht das 5. Buch des CIC in einem inneren Sinnzusammenhang mit dem übrigen CIC, denn alle Selbstvollzüge der Kirche in der Verkündigung, dem Heiligungsdienst und auch der Strukturiertheit in der kirchlichen Verfassung und Organisation bedürfen zu ihrer Ermöglichung finanzieller Mittel. Aus systematischen Gründen hat sich der Gesetzgeber dazu entschieden einige Normen, die das Vermögensrecht unmittelbar betreffen, strukturell aber doch eher zum kirchlichen Verfassungsrecht oder zum Heiligungsdienst gehören, dort zu regeln. Das gilt etwa für die Organisation der Vermögensverwaltung in den Religioseninstituten (cc. 634-639), die Bestimmungen über die Verwaltungsorgane auf diözesaner und pfarrlicher Ebene, genauerhin den Vermögensverwaltungsrat, das Konsultorenkollegium (cc. 502 § 3, 494 §§ 1 u. 2) und den Pfarrvermögensrat (c. 537). In weiten Teilen der Kirche bilden die Messstipendien (cc. 945-958) das Grundeinkommen vieler Priester. Obwohl es sich dabei eindeutig um eine vermögensrechtliche Kategorie handelt, hat der Gesetzgeber sie aktuell im Sakramentenrecht verortet, vor allem, damit der geistliche Charakter deutlicher hervortritt und jede Geschäftemacherei mit „sakramentalen Dienstleistungen“ (vgl. c. 947) zurückgedrängt wird.
Merke:
Das Vermögensrecht des CIC/1983 ist ein Rahmenrecht, das allein der Komplexität vermögensrechtlicher Wirklichkeiten nicht genügen kann.
Universalkirchliches Vermögensrecht findet sich in den Büchern II, IV und V des CIC.
Partikulares Vermögensrecht findet sich in den Amtsblättern der deutschen Diözesen.
1. Grundlegende Begriffe des kirchlichen Vermögensrechts
Als die drei wesentlichen Grundfunktionen der Kirche werden mit Blick auf das Lebensbeispiel Jesu Christi die Verkündigung des Glaubens, die Feier des Gottesdienstes und die Ausübung der Nächstenliebe qualifiziert. Um diese Aufgaben in der real existierenden Welt zu erfüllen, bedarf die Kirche seit jeher irdischer Güter (mobiles und immobiles Vermögen), so wie sich auch Jesus selbst dieser nach seinem Bedarf bedient hat. Insofern besteht kein prinzipieller, wohl aber ein durchaus erheblicher gradueller Unterschied zwischen der biblischen, nachbiblischen und institutionell kirchlichen Zeit. Die hauptsächlichen Ausgabenposten entstehen für die Finanzierung der Personalausgaben und der Sachausgaben in den drei kirchlichen Grundfunktionen. Daher formuliert der Einleitungskanon in das kirchliche Vermögensrecht, c. 1254 § 2 die Hauptzwecke des Kirchenvermögensentsprechend: Durchführung des Gottesdienstes,sowie Ausübung der kirchlichen Sendungund der Caritas.Für alle diese Aufgaben bedarf es Menschen, die sich ganz oder teilweise in Dienst nehmen lassen. Insofern ist die Sicherstellung des Unterhalts von Geistlichen und anderen kirchlichen Bediensteten ein weiterer Hauptzweck des kirchlichen Vermögens.
Der kirchliche Gesetzgeber wählt seit jeher die lateinische Bezeichnung bona temporaliafür zeitliche Güter, die kirchlichen Rechtspersonen gehören. Die Bezeichnung bona temporalia wird als Gegenüber zu den bona spiritualia verstanden, über die vor allem die Bücher III und IV des CIC/1983 handeln. Der Begriff der Temporalien umfasst nicht nur dingliches und monetäres Vermögen im engeren Sinne, sondern traditionell die Gesamtheit der Güter, die kirchlichen Zwecken zu dienen bestimmt sind. 3Das Kirchenvermögen im engeren Sinne hingegen bezeichnet die Vermögenstücke und Ver- mögensrechte, die kirchlichen Rechtsträgern gehören. Dabei kommt es entscheidend auf das Rechtsverhältnis der Sache zu einem kirchlichen Vermögensträger, nicht jedoch die ursprüngliche oder gegenwärtige Zweckbestimmung derselben, an. Das gilt sowohl hinsichtlich des Eigentums als auch des tatsächlichen Besitzes, mindestens aber der rechtlichen Herrschaftsmacht an der vermögenswerten Sache. Daher ist mit Blick auf den betreffenden Vermögensgegenstand zu unterscheiden zwischen dinglichen Rechten (ius in re), als das Eigentum und den Besitz der Sache selbst und Forderungsrechten (ius ad rem), also dem rechtlichen Anspruch an einen Dritten, eine vermögenswerte Leitung zu erbringen. Ein dingliches Recht ist z. B. das Eigentum an einer Kirche oder einer anderen Immobilie, oder aber auch an Geldvermögen. Forderungsrechte sind z. B. Mieten, Pachten, Zinsen und Erträge aus Verträgen, die Rechtspersonen mit einer kirchlichen Rechtsperson eingegangen sind. Bei beiden Vermögensformen kommt es nicht auf die Zweckbestimmung des Gegenstandes an, sondern auf das Recht daran, welches die kirchliche Rechtsperson hat. Der kirchliche Zweck an nicht originär kirchlichen Vermögensstücken besteht darin, dass diese der Bestandssicherung oder Erweiterung des kirchlichen Vermögens dienen und in zweiter Linie so einem der genannten kirchlichen Zwecke zufließen können.
Читать дальше