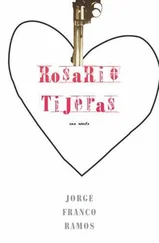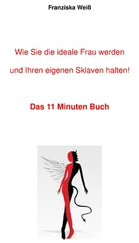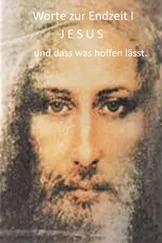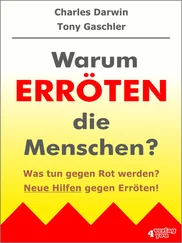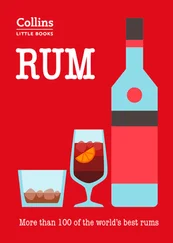Klaus Hock, Professor für Religionsgeschichte an der Universität Rostock, beobachtet in der Philosophie und Theologie bisweilen apologetische Bemühungen, „in der Religiosität eine in der menschlichen Natur mitgegebene Größe jenseits aller konkreten Ausdrucksformen von Religion zu finden.“ (vgl. Hock 2009, S. 399 f.) Auch religionssoziologische wie -psychologische Untersuchungen könnten keine abschließende Antwort auf die fundamentale Frage geben, ob wir es bei Religiosität mit einer „anthropologischen Grundkonstante“ zu tun haben, „die substanziell zum Wesen des Menschen gehört“, oder eher mit einem „Akzidens, dessen Vorhandensein (oder Fehlen) durch ein Ensemble unterschiedlichster Faktoren zustandekommt“, also nicht essenzialistisch in der Grundstruktur des Menschen angelegt sei (ebd., S. 402).
Eine für alle überzeugende Antwort, inwieweit eine religiöse bzw. spirituelle Dimension zum Menschen gehöre, wird sich auch hier nicht darstellen lassen. Versucht werden soll aber ein Mosaik namhafter Stimmen (v. a. des 20. und 21. Jh.s) aus unterschiedlichen Fächern, die dieses komplexe Phänomen aus verschiedenen Richtungen beleuchten und so seine Relevanz und Vielfalt aufscheinen lassen. Denn selbst „eine“ religiös-spirituelle Dimension wäre keine eindimensionale Erscheinung.
2.1 Philosophische Gesichtspunkte
Vor der philosophischen Reflexion steht die Wahrnehmung, oft auch erst das Staunen, wie Aristoteles bemerkte. In der Vielfalt religiöser Phänomene versuchen die Religionswissenschaften, ordnende Kategorien zu finden. Eine sehr einflussreiche, auch religionspsychologisch brauchbare Definition von Religion hat 1966 der Ethnologe Clifford Geertz vorgelegt:
Eine Religion ist (1) ein Symbolsystem, das darauf zielt, (2) starke, umfassende und dauerhafte Stimmungen und Motivationen in den Menschen zu schaffen, (3) indem es Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung formuliert und (4) diese Vorstellungen mit einer solchen Aura von Faktizität umgibt, daß (5) die Stimmungen und Motivationen völlig der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen. (Geertz 1983, S. 48) 59
Ein Symbolsystem hat mit der Deutung von Wirklichkeit zu tun, was auch für den Religionsphänomenologen Jacques Waardenburg zentral ist. Er zählt als die drei wesentlichen Merkmale von Religion auf: „religiös gedeutete Wirklichkeiten“, „religiös gedeutete Erfahrungen“ und „religiös gedeutete Normen“ (vgl. Waardenburg 1986, S. 18–23). Das könnte tautologisch klingen oder wie eine bloße Explikation des Begriffs Religion , verdeutlicht aber den – philosophisch wie theologisch sinnvollen – Ansatz, dass Religion und ihr intendiertes Gegenüber (wie etwa Gott selbst) nicht direkt greifbar sind, sondern eine Deutung des Gegebenen verlangen.
Der Philosoph Bernhard Irrgang vermerkt beim Eintrag „Mensch“ im Lexikon philosophischer Grundbegriffe der Theologie: „Als grundlegende Wesenszüge des M.en gelten seine Vernunft und seine Freiheit, seine Sprachfähigkeit, seine Moralität, seine Sozialität, sein Selbst- und Todesbewusstsein, aber auch der aufrechte Gang, Kultur, Technik, seine Weltoffenheit und sein Transzendenzbezug bzw. seine Religiosität.“ (Irrgang 2007, S. 263)
Ähnlich hält Holger Zaborowski im Neuen Handbuch philosophischer Grundbegriffe fest, Religion sei ein
Grundvollzug oder -phänomen des Menschseins. Religion ist ein Phänomen, das sich empirisch seit den Anfängen der Menschheit nachweisen lässt […] Der Mensch verfügt nicht nur über Vernunft, Selbstbewusstsein oder Sprache; es ist für ihn auch charakteristisch, ein religiöses Wesen zu sein. In diesem Zusammenhang wird seit der Zeit der Kirchenväter von der anima naturaliter religiosa des Menschen gesprochen. (Zaborowski 2011, S. 1892)
Freilich ist dies eine offene, freie Möglichkeit für den einzelnen Menschen: „Religion (im Sinne von Religiosität) ist keine naturwüchsige Tatsache, sondern eine natürliche Möglichkeit des Menschseins, die es in Freiheit anzueignen und kulturell zu bestimmen gilt.“ (ebd., S. 1893) 60
Eine schöne Beschreibung grundlegender religiöser Erfahrung gibt ein Beitrag von Rüdiger Safranski:
Ich habe also weniger eine bestimmte Religion als System oder gar als Institution meinen Überlegungen zugrunde gelegt, sondern eine religiöse Erfahrung zu skizzieren versucht, die ich zusammenfassend so charakterisieren kann: es handelt sich dabei um jene Erfahrung, die im Leben und im Sein insgesamt ein letztlich unauflösbares Geheimnis und einen unerschöpflichen Reichtum sieht – und die von diesem Umgreifenden angerührt ist. Diese Erfahrung gibt es in unterschiedlichen Graden von Intensität. (Safranski 2002, S. 19) f.)
Auch er sieht sie als eine Möglichkeit: „Religiöse Erfahrung in diesem Sinne ist nicht etwas, woran man glauben müßte. Es gibt sie mit aller nötigen Selbstevidenz. Nur – nicht jeder macht sie.“ (ebd., S. 20) Sie ist grundgelegt im menschlichen Bewusstsein und damit in der Fähigkeit zur Transzendenz:
Der Mensch ist ein Wesen, das transzendieren, das heißt: über sich hinausgehen kann; […] Für dieses transzendierende Vermögen gibt es unendlich viele Formulierungen; die vielleicht schönste haben Goethe und Schelling gefunden, als sie erklärten: Der Mensch ist Natur; aber im Menschen schlägt die Natur ihre Augen auf und bemerkt, daß sie da ist. Im Menschen ist die Natur gesteigert zur Selbstsichtbarkeit und damit zur Selbsttranszendenz. Daraus erwächst das große Staunen darüber, daß es das Sein gibt und nicht das Nichts. (ebd., S. 25)
Das bleibt kein nur individuelles Phänomen, sondern bekommt gemeinschaftliche Gestalt: „Aus diesem Spielraum des Transzendierens sind auch die Religionen erwachsen. Sie sind Versuche, der Transzendenz, auf die hin wir transzendieren können, ein bestimmtes Gesicht zu geben.“ (ebd., S. 26)
Der Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Welte hat auf seine ganz eigene phänomenologische Art menschliche Bedingtheit, Freiheit und Transzendenz aufgewiesen. Zu allem Gegebenen könne der Mensch sich verhalten und Stellung nehmen, da sei ein „ich selbst“, ein innerster Punkt, der nie Objekt werden könne (vgl. Welte 1969, S. 50–56). Alles menschliche Sich-Verhalten habe ein „Worumwillen“, ein im weitesten Sinne sinngebendes Element, das alles umfassend und auch alles überschreitend sei: Für den Menschen gebe es – anders als für Tiere – keine begrenzte Welt als einen „begrenzten Spielraum seines Verhaltens“, sondern für „ihn ist die alles umfassende und alles übersteigende Transzendenz eröffnet.“ (vgl. ebd., S. 61) f.) Daraus folgert er: Ist der Mensch
einerseits ein einzelnes und begrenztes Naturwesen, so ist er andererseits alle Natur umfassend und übergreifend und darum auch aller Natur gegenüber. Verlängern wir an diesem Punkte unsere Betrachtungen um ein Weniges, dann können wir es wagen zu sagen: Der Mensch ist in der Transzendenz seines Umwillen immer schon ausgerichtet auf das Allumfassende, Unbegrenzte und Unbedingte und von diesem beansprucht. Im Hinblick auf diesen Zusammenhang kamen ältere Denker nicht ohne Grund auf den Gedanken, das Allumfassende, Unbegrenzte und Unbedingte, das den Menschen in seiner Freiheit immer schon beansprucht, sei das, was in der Sprache der Religion Gott genannt wird, und der Mensch sei also im Grunde oder in der Spitze seines Wesens von Gott beansprucht oder von Gott angerührt oder Gott berührend. (ebd., S. 87)
Der Mensch habe im Ganzen eine Stellung des „Zwischen“: „zwischen Natur und dem, was mehr ist als Natur“ – in der neuplatonischen Tradition wurde deshalb das Menschenwesen auch „Wesen der Grenze“ genannt (vgl. ebd., S. 88) f.). 61
Für Welte grundlegend ist auch die elementare Verbindung von Hoffnung und Sinn im menschlichen Dasein:
Читать дальше