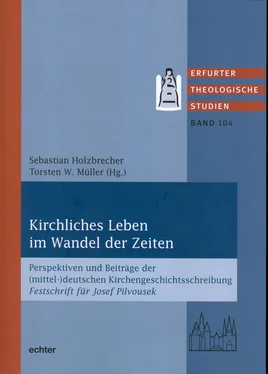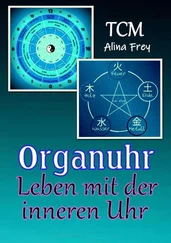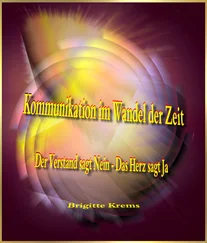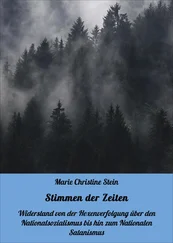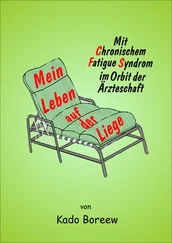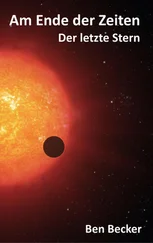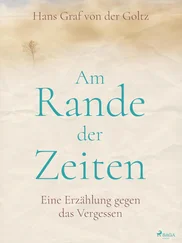Um den unbequemen Geist aus dem Rheinland abzuziehen, bot ihm die preußische Regierung einen Lehrstuhl in Berlin an. Er lehnte ihn ab mit dem Hinweis, wenn er in Berlin zu einem Lehramt tauge, dann tauge er auch für seine Professur in seiner Heimat, nämlich an der neu errichteten Universität Bonn. Zuvor hatte er einen Ruf nach Lüttich ebenso abgelehnt wie die Berufung auf die Leitung der Stuttgarter Kunstschule. Görres befürchtete eine Verminderung seiner publizistischen Wirksamkeit, wenn er seinen heimischen Humus verlöre.
Nach der Ermordung des Dramatikers und russischen Staatsrates August von Kotzebue durch den Studenten Karl Ludwig Sand reagierten die preußischen Behörden mit verschärfter Repression. Kotzebue hatte in seinem 1818 gegründeten „Literarischen Wochenblatt“ die freiheitlichen Ideen des Wartburg-Festes verspottet. Die harte Reaktion des Staates auf das Attentat ließ Görres erneut zur Feder greifen. Unter dem Titel „Teutschland und die Revolution“ (1819) verfasste er eine in glühender Sprache gehaltene Kampfschrift gegen den Polizeistaat. Erneut sagte er sich von seiner jakobinischen und radikaldemokratischen Vergangenheit los und plädierte für die bewahrenden Kräfte von Monarchie und Kirche. Er hob die wichtige Rolle der Religion für die Sicherung geistiger und politischer Freiheit hervor. Nach Abschluss des Manuskriptes sagte Görres: „In Berlin wird’s diesmal sehr donnern.“ 14 Es war mehr als Donner: Friedrich Wilhelm III. erließ per Kabinettsorder einen Haftbefehl gegen Görres und wollte ihn in die Festung Spandau bringen lassen. Görres erfuhr rechtzeitig von der drohenden Verhaftung und setzte sich nach Frankfurt ab. Als er auch dort verfolgt wurde, floh er nach Straßburg ins Exil. Dort sollte er bis 1827 bleiben, einschließlich eines einjährigen Aufenthaltes in der Schweiz.
IV .
Die Trennung vom Rheinland für den Rest seines Lebens markiert eine wichtige Zäsur in Görres’ äußerem Lebensweg. „Sein Vaterland hat ihn ausgespien“, kommentiert sein Freund Clemens von Brentano den neuen Wohnort. 15 Es ist nicht ohne Ironie, dass Görres, der Frankreich so lange bekämpfte, in Straßburg Zuflucht finden sollte und die Stadt ihn mit offenen Armen empfing. Benjamin Constant begrüßte ihn als den von den Königen Europas Verfolgten. Die Pariser Zeitung „Moniteur“ stellte ihn pathetisch unter Frankreichs Schutz. In Straßburg könne er, wie ihn Achim von Arnim tröstet, „die Periode der Dummheit bequem abwarten.“ 16 Dort kam Görres tatsächlich zur Ruhe und setzte seine schriftstellerische Tätigkeit fort.
Im Exil weitete sich das Blickfeld von Joseph Görres auf Europa aus. In nur 27 Tagen verfasste er seine Schrift „Europa und die Revolution“ (1821). Es ist die wahrscheinlich bedeutendste und tiefsinnigste seiner politischen Schriften. In ihr hielt er Europa das politische Elend seines gegenwärtigen Zustands in einer an das Alte Testament erinnernden Sprache vor Augen. Erneuerung und Wiedergeburt vermögen die Staaten nur durch innere Festigung erreichen. Ein lebensfähiger und zukunftsfester Staat gelinge nur auf der Grundlage der Religion, die – verkörpert in der Kirche – allein den Völkern Europas geistige und politische Freiheit sichern könne. 17 Auch dieser Schrift wurde die Ehre zuteil, von der preußischen Regierung verboten zu werden mit dem Argument, sie gefährde die Monarchie. Aber Görres ließ sich nicht entmutigen. Schon im nächsten Jahr erschienen neue Veröffentlichungen, in denen er die erdrückenden Folgen der Restauration für die Freiheitsrechte nach dem Wiener Kongress darlegte.
Schon während seiner Arbeit am „Rheinischen Merkur“ hatte Görres seinen Frieden mit der katholischen Kirche gemacht, vorbereitet auch durch seine historischen und mythologischen Studien. 1824 kehrte er mit seiner Familie auch formell in die Kirche zurück, ließ sich kirchlich trauen und entwickelte ein lebhaftes Interesse an theologischen und kirchenpolitischen Fragestellungen.
V .
Im Herbst 1827 erhielt Joseph Görres einen Ruf an die Münchner Universität. Er nahm ihn an und konnte so ehrenvoll nach Deutschland zurückkehren. König Ludwig I. von Bayern hatte sich mit dieser Berufung allen preußischen Einwänden widersetzt. Zu Beginn seiner Regierung war Ludwig I. ein äußerst reformfreudiger Monarch und hatte eine Verlegung der altbayerischen Universität Landshut in die bayerische Hauptstadt verfügt. Er wollte so eine Chance für einen organisatorischen, ideellen und personellen Neuaufbau eröffnen. Der Ruf an Görres zum Wintersemester 1827/28 war trotz der Sparpolitik des Königs zustande gekommen, um mit dem „genialen Görres“ der Münchner Universität Anziehungskraft auf die akademische Jugend zu verschaffen. Sein universalistischer Wissenschaftsgeist, sein hohes Bildungsethos und seine ausstrahlende geistige Potenz sollten möglichst viele Hörer anlocken. Nicht zuletzt wurde die Universität mit der Hoffnung konfrontiert, dass Görres „der christlichen katholischen Richtung ein entschiedenes Übergewicht“ verschaffen sollte. 18
Görres wurde der Lehrauftrag erteilt für „Allgemeine und Litteratärgeschichte“. Heimisch wurde Görres in München nicht, zu tief war seine rheinische Verwurzelung. Aber er avancierte bald zur Zentralfigur eines Kreises. Hatte er zuvor in Heidelberg die Romantiker um sich versammelt, so wurde er in München zum Mittelpunkt eines kirchenpolitischen Engagements für eine Erneuerung des katholischen Deutschlands. Dieser Kreis von katholischen Gelehrten hatte schon den Ruf von Görres nach München begrüßt und versuchte, das Übergewicht der aufklärerischen protestantischen Wissenschaft und des weltanschaulichen Liberalismus auszutarieren. Zu diesem Kreis gehörten der Philosoph Franz Baader, der Theologe Ignaz Döllinger, der spätere Bischof von Eichstätt Georg von Öttl und der spätere Bischof von Regensburg, Franz Xaver von Schwäbl.
Diese Persönlichkeiten fanden sich zu regelmäßigen Treffen in einem Lokal und bildeten den Kern einer Mannschaft, die sich – verstärkt durch Görres – entschloss, eine Zeitschrift herauszubringen, welcher der programmatische Name „Eos“ gegeben wurde. Von ihren Gegnern wurde der Eos-Kreis rasch mit dem Etikett „Congregation“ belegt, um „Jesuitismus, Ultrakonservatismus und Geheimbündelei“ zu insinuieren. Dabei war der Kreis weit von einer homogenen Geschlossenheit entfernt. Bei den Treffen wurde über alle aktuellen Themen in Wissenschaft, Politik und Kunst debattiert. Zu jedem Thema gab es mindestens so viele Ansichten wie Teilnehmer. Dieser Kreis war auch offen für Protestanten.
Görres’ Start als Hochschullehrer geriet fulminant. Nicht nur Studierende, auch Freunde, Männer des öffentlichen Lebens, Künstler und Durchreisende wollten den berühmten Mann hören und sehen. Kein Hörsaal reichte aus, um die Zahl seiner Zuhörer zu fassen. Die neue Hochschulpolitik Ludwigs I. hatte völlige Studienfreiheit durchgesetzt. Die auf sechs Semester berechneten Berufsfächer ließen in einem langen fünfjährigen Studium ausreichend Zeit, die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten der Universität zu nutzen. So wurde der Besuch von juristischen, theologischen und philosophischen Vorlesungen für alle Studierenden möglich. Von diesem Studium Generale profitierte Görres. Die Studenten richteten hochgespannte Erwartungen an ihn als eine nationale und weltanschauliche Symbolfigur. Das galt für seine Anhänger wie auch für seine Gegner. 19 „Lebte er nicht hier, so wäre München ein gewöhnlicher Ort“, rühmte Clemens von Brentano 1833 die Bedeutung seines Freundes Görres für die Bedeutung der Hauptstadt. 20 Görres war als Exponent einer universalistischen Wissenschaftskonzeption nach München gerufen worden, und er hat die Chance ergriffen, die sich ihm an der neustrukturierten Universität bot. Seine Lehrtätigkeit war fachübergreifend. Er wollte das Wissen seiner Zeit anbieten in einer weltanschaulich orientierenden Gesamtschau.
Читать дальше