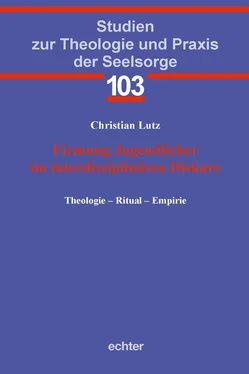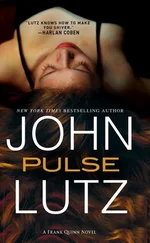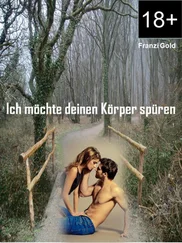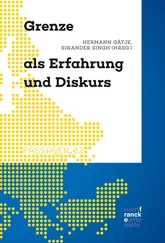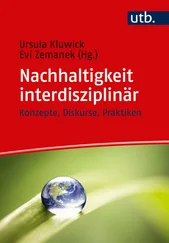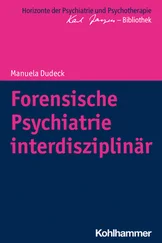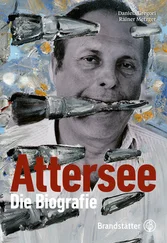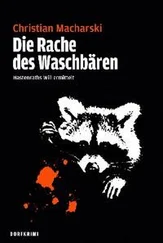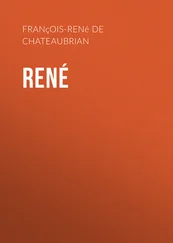Ein wesentliches Ziel der Arbeit ist es, mittels der Sachthemen einen interdisziplinären Diskurs zwischen Theologie, Ritualwissenschaften und empirischen Wissenschaften zu ermöglichen. Die erkenntnistheoretischen Standpunkte und die Methoden dieser Wissenschaften sind zwar verschieden. Es existieren aber auch eine große Anzahl an Überschneidungen, wie die Frage nach der Bedeutung des Alltags der Menschen oder der persönlichen Religiosität Jugendlicher.
Aufbau der Arbeit
Damit ergibt sich folgender Aufbau der Arbeit: im ersten Kapitel wird die normative Ausgestaltung der Firmung in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils und der postkonziliaren synoden in Deutschland dargestellt. Dabei werden die Sachfragen benannt, die für Arbeit zentral werden. Diese sind: Biographie, Gemeinschaft, Gottesbild, Gabe und Aufgabe, Glaubensleben, Kommunikation, Passageritual und Alter. Mit diesen Kriterien soll überprüft werden, was ritualtheoretische und empirische Wissenschaften darauf antworten können und wie mit ihnen das sakrament der Firmung theologisch verantwortet dargestellt werden kann. Bereits die Firmtheologie Thomas von Aquins kann unter dem Ausgangspunkt der Biographie entwickelt werden. Im Fokus steht aber nicht die Geschichte der Firmtheologie, die Manfred Hauke in seiner Habilitationsschrift umfassend dargestellt hat. In diesem Kapitel geht es um die Theologie im 20. und 21. Jahrhundert. Hierbei zeigt sich, dass die Firmtheologie Karl Rahners von dem Ausgangspunkt des Glaubenslebens und Hans Urs von Balthasars Firmtheologie von dem Gesichtspunkt Gabe und Aufgabe her erschlossen werden kann. Ebenso gibt es im 20. und 21. Jahrhundert eine reichhaltige Auseinandersetzung mit der Firmung, die von dem Kriterium Kommunikation aus erschlossen werden kann. Dazu gehören die so genannte kommunikative Theologie aber auch Arbeiten von Patrik Höring und Lothar Lies. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf die Feier der Konfirmation in den evangelischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften und der Aufbereitung der Sachfragen für die interdisziplinäre Arbeit im vierten Kapitel.
Das zweite Kapitel handelt von den Potentialen rituellen Handelns. Die Auswahl ritualtheoretischer Beiträge richtet sich danach, sowohl ältere, umfassende Darstellungen von Ritualen zu untersuchen als auch jüngere Ritualtheorien, die der Ausdifferenzierung des Rituals in postindustriellen Gesellschaften Rechnung tragen, um die Relevanz rituellen Handelns zu erklären. Nach jedem Unterkapitel werden die Ergebnisse anhand der Sachfragen gesammelt und überprüft, welche Sachfragen von den Ritualtheorien beantwortet werden können. Dabei fällt nur ein einziges Kriterium heraus, das nicht von den ritualtheoretischen Beiträgen beantwortet werden kann: die Frage nach dem Firmalter. Das hängt damit zusammen, dass die klassischen Ritualtheorien verschiedene Rituale untersuchen, die in unterschiedlichen Gesellschaften zu diversen Altersstufen gefeiert werden und die neueren Ritualtheorien Rituale in postindustriellen Gesellschaften untersuchen, bei denen es keine fest gelegte Altersstufe gibt. Das Kapitel schließt mit der Frage nach der Effektivität der Rituale und einem kurzen Blick auf die Jugendweihe bevor die Sachfragen für die interdisziplinäre Zusammenschau aufgearbeitet werden.
Im dritten Kapitel wird von den gewählten empirischen Studien ausgegangen. Sie wurden so gewählt, dass sowohl akademische als auch kirchliche studien herangezogen werden konnten. Neben diesen Einzelstudien werden auch religionssoziologische und religionspsychologische studien untersucht, die die jugendlichen Religiosität auf umfassende Weise zu beschreiben versuchen. Zusammen mit diesen Studien wird zu Beginn ein Ausblick auf die Religiosität in der Kindheit gegeben, um deutlich zu machen, welche Entwicklungsaufgaben Jugendliche in ihrer Religiosität vor sich haben. Auch in diesem Kapitel ist die sachfrage nach dem Alter schwer zu beantworten, weil die einzelnen empirischen studien unterschiedliche Altersgruppen Jugendlicher befragen. Religionspsychologische und kognitionswissenschaftliche studien werden letztlich herangezogen, eine möglichst umfassende Darstellung jugendlicher Religiosität zu gewährleisten. Den Abschluss bildet wieder die Aufbereitung der Sachthemen.
Im vierten Kapitel werden die einzelnen Sachfragen der Reihe nach behandelt. Hier sollen die interdisziplinären Perspektiven zum Tragen kommen. Besondere Bedeutung erlangt dabei die Frage nach der theonomen und der autonomen Verfassung des Menschen, die in spätmoderner Zeit in neuen Zusammenhängen steht.
1Vgl. zur Geschichte der Firmung: NEUNHEUSER, Burkhard, Taufe und Firmung. In: SCHMAUS, Michael / GEISELMANN Josef R. / GRILLMEIER, Aloys, Handbuch der Dogmengeschichte. Band IV Sakramente. Faszikel 2. Freiburg 1956 und HAUKE, Manfred, Die Firmung. Geschichtliche Entfaltung und theologischer Sinn. Paderborn 1999.
2Vgl. PAUL VI, Constitutio Apostolica De Sacramento Confirmationis. Divinae Consortium Naturae. In: ACTA APOSTOLICAE SEDIS 63 (1971), 657-664.
3Vgl. CIC, can. 889-896.
4Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo Confirmationis . Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis 1973 und Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo Initiationis Christianae Adultorum . Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
5Vgl. VONDEY, Wolfgang, Heribert Mühlen. His Theology and Praxis. A New Profile of the Church. Lanham MD, 2004, 297 ff.
6MÜHLEN, Heribert, Neue Gestalt des Christseins. In: DERS. (Hrsg.), Geistesgaben heute. Mainz 1982, 33-49, hier 39.
7MÜHLEN, Die Firmung als sakramentales Zeichen der heilsgeschichtlichen Selbstüberlieferung des Geistes Christi. In: THEOLOGIE UND GLAUBE 57 (1967), 263-286, hier 285.
8MÜHLEN, Die Erneuerung des christlichen Glaubens. München 1974, 231.
9BIEMER, Firmung. Theologie und Praxis Pastorale Handreichungen Band 6. Würzburg, 1973, 36.
10Vgl. BIEMER, Firmung. Theologie und Praxis, 35 ff. Einen ähnlichen Ansatz vertritt Günter Biemer auch in einer späteren Veröffentlichung: Vgl. BIEMER, Symbole des Glaubens leben. Symbole des Lebens glauben. Sakramtenkatechese als Lernprozeß. Taufe. Firmung. Eucharistie. Ostfildern 1999, 179 f.
11BIEMER, Firmung. Theologie und Praxis, 41.
12BIEMER, Firmung. Theologie und Praxis, 42.
13BIEMER, Angesichts der Theodizeefrage Sakramente lehren und lernen. In: LESCH, Karl Josef / SALLER, Margot (Hrsg.), Warum Gott…? Der fragende Mensch vor dem Geheimnis Gottes. Festschrift für Ralph Sauer zum 65. Geburtstag. Vechtaer Beiträge zur Theologie 2. Kevelaer 1993, 169-177, hier 177.
14Zum Problem der Integration verschiedener theologischer Modelle in eine einheitliche Sichtweise vgl. LUTZ, Christian, Theologie in der Kirche. Eine Untersuchung der methodologischen Grundlagen der Theologie und des Verständnisses der Katholizität der Kirche bei Avery Kardinal Dulles und Leo Kardinal-Scheffczyk. Frankfurt 2009, 43 ff. Hier dargestellt anhand der Modelltheorien Avery Dulles’.
15AMOUGOU-ATANGANA, Jean, Ein Sakrament des Geistempfangs? Zum Verhältnis von Taufe und Firmung. In: KÜNG, Hans / MOLTMANN, Jürgen (Hrsg.), Ökumenische Forschungen. III Sakramentologische Abteilung. Band 1. Freiburg 1974, 12.
16AMOUGOU-ATANGANA, Jean, Ein Sakrament des Geistempfangs?, 59.
17AMOUGOU-ATANGANA, Jean, Ein Sakrament des Geistempfangs?, 286.
18Vgl. SCHWALBACH, Ulrich, Firmung und religiöse Sozialisation. Innsbrucker theologische Studien Band 3. Innsbruck 1979, 36: „Vereinfacht dargestellt, scheint das Problem der Firmung die Gewissensfrage zu stellen, ob die Schrift oder die Tradition ab dem Mittelalter verpflichtender Maßstab für eine heutige Entscheidung sein soll“.
Читать дальше