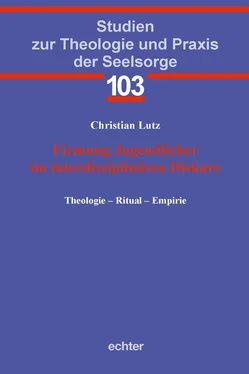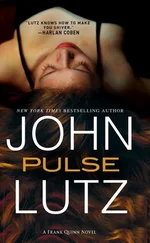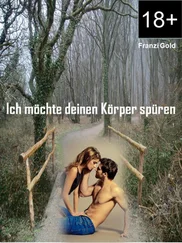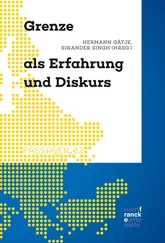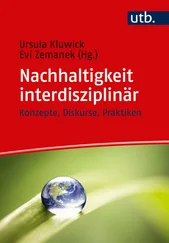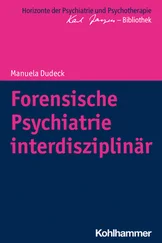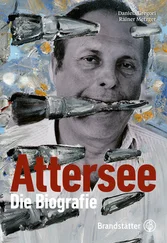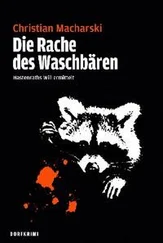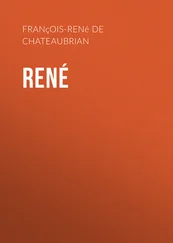Wer sich von Gott abwendet, wird deshalb zu einem Verlassenen, der sich von jeder Liebe abgewandt hat. Doch auch einem solchen Menschen begegnet nach Balthasar einer, der noch verlassener ist, der Gekreuzigte, Jesus Christus 283. Durch dieses Engagement Gottes kann nun der Sünder in einen noch größeren Widerspruch zu Gott gebracht werden 284, dennoch möchte Balthasar in seinem Denken den Raum für das Handeln des je größeren Gottes offen halten 285. Der sündige Mensch ist bei Balthasar immer als eine der Liebe abgewandte Person beschrieben. Aber ein Nein zur Liebe Gottes bedeutet heute nicht auch Verlassenheit. Es gibt Vereine, die sich genau dieses Nein zu Gott zum Ziel gesetzt haben wie der Humanistische Verband Deutschlands, der Menschen auch Trauerrituale anbietet oder Anregungen gibt, Hochzeitsfeierlichkeiten zu gestalten 286. Damit ist gerade in dem Bereich der Liebe, den Balthasar als einen Kernbereich einer sich auf eine weitere Perspektive hin öffnende Größe verstanden hat, ein Nein zu Gott möglich und dieses Nein wird auch noch beworben als eine weitere Perspektive als es verschiedene Glaubensrichtungen ermöglichen würden, schließlich würden Glaubenssätze einengen oder auch Traditionen mit sich bringen, die längst überwunden wären. Die individuellen Bedürfnisse und Sehnsüchte könnten auch ohne Gott gedeckt werden.
Einen solchen Blick von außen auf die Kirche und auf die Beziehung zu Gott würde Balthasar nicht gelten lassen. Denn: „Im Kommen und Mitgehen allein ergibt sich die wirkliche Schau; diese kann nicht von Außen […] verfolgt werden, sondern nur im Mitabschreiten der durchmessenen Strecke. […] Der Geist führt ja von Anfang an in das ganze Phänomen Jesu Christi ein: in sein Leben, Sterben, Auferstehen. Deshalb wird sich die mitgehende Theorie nicht anders ereignen und zu wirklicher Anschauung gelangen als […] in einem sofortigen Mitleben, Mitsterben, Mitauferstehen, wodurch erst der Eintritt in den Auslegungsraum des Sohnes verbürgt wird“ 287. Damit muss ein Mensch sich auf die Beziehung zu Gott letztlich einlassen und die Lebensstrecken mit der weiteren Perspektive Gottes auf sein Leben abschreiten. Dies hängt sowohl mit der Leiblichkeit des Menschen zusammen, der immer zeitlich angelegt ist als auch mit der Art und Weise der Offenbarung, die sich in der Geschichte ereignet. Wie es allerdings möglich sein soll, Menschen von dem Wert dieses Miterlebens zu überzeugen, erklärt Balthasar nicht. Es bleibt eine Charis, eine Gnade. Und damit dürfte auch die tiefste Bestimmung des Charismas bei Balthasar geklärt sein: es liegt in der gnadenhaften Zugehörigkeit zur Kirche und dem Bewusstsein aus einer Beziehung mit Gott das Leben zu gestalten. Auch dann, wenn es alternative Lebensentwürfe gibt, die der Kirche indifferent gegenüber stehen. Auch dann, wenn Christinnen und Christen unter Verfolgung zu leiden haben und mit dem Leben für ihre Zugehörigkeit zu Christus bezahlen müssen 288.
Christliche Sendung und die Sendung eines Christen / einer Christin in der Firmung wird man deshalb niemals nur mit rein anthropologischen Gründen erklären können. Und umgekehrt wird man die persönlichen Beziehungen im Leben von Christen niemals ganz ohne die weitere Perspektive Gottes verstehen können. Dazu gehören die freudigen Momente, mit Sicherheit aber auch die Brutalitäten des Alltags, die Christen in der Person Jesu deuten sollen und deuten können. Damit sind Christen immer auch auf die Offenbarung in ihrer konkreten Gestalt hingewiesen: auf die neutestamentlichen Berichte von Jesus, die niemals in ihrer Gänze zu entmythologisieren wären. Zugehörigkeit zur Kirche heißt deshalb, dass jeder Christ / jede Christin mit hinein genommen ist in die Liebesbeziehung Gottes, in die der Heilige Geist einführt und die in ihrer eschatologischen Vollendung immer noch Liebesbeziehung Gottes zu seinem Geschöpf ist.
Für die Firmung Jugendalter bietet das Bild vom Kleinkind in seiner Beziehung zu seiner Mutter keine Grundlage zur Verdeutlichung der Beziehung Gottes zum Menschen. In der Theologie Balthasars steht dieses Bild jedenfalls nicht für Fremdbestimmung, Infantilität oder auch Unmündigkeit, sondern für die personale Beziehung schlechthin, die jeder Christ / jede Christin in ihrem Leben mit gegeben ist. Gerade dann, wenn Menschen nicht mehr auf der Suche nach Gott sind, oder nichts mehr von ihm erwarten, müsste nach Balthasar ihnen Gott mit seiner Liebe entgegenkommen als der immer Größere. Diese unerwartete Ankunft Gottes zeigt sich schon in der Offenbarung, in der Gott den Menschen auf ganz andere Art und Weise begegnet, als sie das erwartet hätten. Es bleibt zu hoffen, dass sich Gott auch heute Menschen überraschend zeigt, wenn sie gar nichts mehr von ihm erwarten 289.
1.4.3 Firmung ist Empfänglichkeit und Entscheidung
Wenn Balthasar in Bildern von der Kirche spricht, dann gehören die Metaphern von Männlichkeit und Weiblichkeit zur Beschreibung des Verhältnisses von Gott zur Kirche mit hinein 290. Die Kirche ist eben Sponsa Verbi – die Braut des Wortes und nimmt damit eine Rolle der Empfänglichkeit und der erhofften Fruchtbarkeit ein. Jeder Christ und jede Christin hat damit eine Art von weiblicher Eigenschaft, nämlich die der Empfänglichkeit 291. Damit wäre Balthasars Blick auf die Rolle der Glaubenden in der Kirche aber nur sehr ungenügend beschrieben, denn sein Name ist untrennbar mit der so genannten dramatischen Theologie im 20. Jahrhundert verbunden. Das zeigt alleine schon der Titel einer seiner Arbeiten Theodramatik. Worauf es Balthasar hierbei ankommt, ist, zu zeigen, dass Aktivität in der Kirche möglich sei – auch wenn ihr zunächst eine Art von empfangender Weiblichkeit zugrunde liegt. Das Bild des Theaters, des Dramas hilft, dies zu verstehen. Karl-Heinz Menke erklärt diese Metapher folgendermaßen:
„Indem er aus der Welt des Theaters Analogien für die Schilderung des einzigartigen Dramas zwischen Gott und Mensch erhebt, spricht er von einer Bühne für das Drama der Weltgeschichte. Gott ist in Christus nicht nur der Autor und Regisseur, sondern auch der Ausführende dieses Dramas. Dennoch ist der einzelne Mensch nicht seine Marionette. Christi Stellvertretung eröffnet den Spielraum für mitspielende Personen, und zwar so, dass diese in dem Maße nicht nur scheinbar, sondern wirklich frei sind, indem sie die Rolle spielen, die ihnen zugedacht ist. Jede Rolle ist eine je einmalige Explikation der Sendung des Erlösers. Balthasar spricht von der exklusiven Sendung und Stellvertretung des Erlösers und den vielen Sendungen und inklusiven Stellvertretungen der Erlösten“ 292.
Im Grunde genommen heißt dies, dass sich in einem Drama freiheitlich verfasste Akteure gegenüber stehen und dass gerade in den Beziehungen Jesu Christi zu den Jüngerinnen und Jüngern ein Freiraum möglich wird, in dem Menschen in ihrer freiheitlich verfassten Existenz am „Selbststand der göttlichen Freiheit“ 293teilnehmen können. Christliches Leben bedeutet also nicht nur Leben in einer empfänglichen, kontemplativen Grundhaltung, es impliziert „auch das, was die Einzelnen selbst aufgrund dieser Teilnahme an der verschenkten Liebe Christi leisten“ 294. Die vier Grundtypen personaler Glaubenserfahrung werden dadurch also erweitert, dass im Bild des Dramas prinzipiell alle alltäglichen Erfahrungen wieder in die Gottesbeziehung mit integriert werden. Denn gerade dadurch, dass sich die Christen von Jesus Christus her vertreten wissen, können sie ihre Sendung leben. Damit beschreibt Balthasar das Drama und die so genannte passive und aktive Stellvertretung der Christen durch Christus ganz ähnlich wie die Sendung Mariens, das Urbild der Kirche: aus ihrer empfangenden Grundhaltung heraus spricht sie ihr Fiat und wird somit aktiv 295. Deshalb wird jedes Reden über die Kirche im Kern zur Christologie 296und findet sein End- und Herzstück in der Mariologie 297. Gerade so wird ein Ergebnis der Auseinandersetzung Balthasars mit dem Exerzitienbuch Ignatius’ von Loyolas verständlich: „‚Indiferencia’ ist die aktive Bereitschaft, Gottes Wahl für je mich zu übernehmen. In diesem Sinne ergibt sich: ‚ Indifferenz ist der Grundakt der Kreatur ’“ 298.
Читать дальше