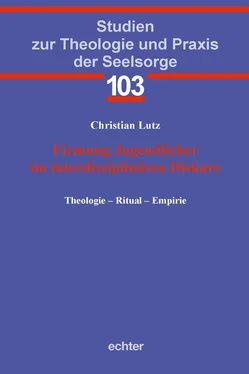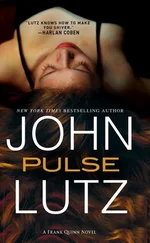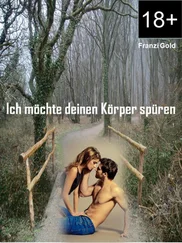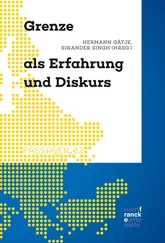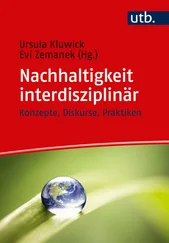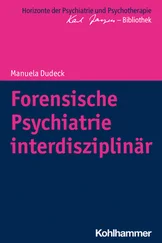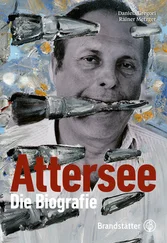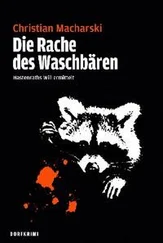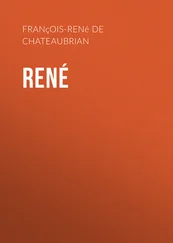1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Thomas bleibt bei dieser Analogie zum biographischen Kontext eines Menschenlebens aber nicht stehen. In seiner Summa Theologiae greift Thomas den Gedanken der perfectio wieder auf und verbindet ihn mit Wachstum und Speise 126. Die Firmung wird hier mit dem Wachstum verglichen, das im Menschen schon selbst angelegt sei. Wenn die Firmung mit diesem Wachstum in Verbindung gebracht wird, dann wird man die Taufe als Grundlage und Ursache dieses Wachstumsprozesses voraussetzen. Der Selbstand des Christen / der Christin wird in der Firmung also vermehrt ( augmentum ) und gestärkt ( confirmatio ). Die Eucharistie hingegen wird mit all dem verglichen, das durch Hinzufügung ( adiunctio ) zur Vervollkommnung gelangt. Refectio erinnert dabei an die Erfrischung, aber auch an das Neu- oder Wiedergeschaffensein, das dem gläubigen Menschen in der Eucharistie widerfährt.
Die Firmung wird bei Thomas allerdings nicht als selbstverständliche Ergänzung der Taufe angesehen. Sie führt zu einer perfectio formalis, weil durch sie ein tugendhaftes Leben besiegelt wird. Dadurch wird sie wieder eng mit der Eucharistie verknüpft, weil die Eucharistie zur perfectio führt, insofern als sie die consecutio finis bezeichnet 127.
In dieser Analogie zur Biographie eines Menschen versteht Thomas eindeutig das Erwachsenenalter als Vervollkommnung des Kindesalters. Vom Jugendalter ist gar nicht die Rede, eine eigene Wertigkeit kommt diesen Lebensabschnitten gar nicht zu. Es wird zumeist von der Stärkung gesprochen, die mit der Firmung gegeben wird. Die Firmung kann aber nicht alleine zur Stärkung des menschlichen Lebens eines Christen / einer Christin beitragen, die Eucharistie darf dabei nicht aus den Überlegungen herausfallen, weil durch sie Stärkung noch einmal ganz sinnlich erfahrbar beim Verzehr der konsekrierten Hostie geschieht. Die Firmung steht dabei in einer merkwürdigen Spannung: einerseits soll sie den Christen dazu befähigen, im öffentlichen Bereich von Christus Zeugnis abzulegen, andererseits soll der Christ dies als Privatperson tun, damit das Sakrament der Firmung nicht mit dem Sakrament der Priesterweihe verwechselt werden kann. Insgesamt aber haben alle Sakramente bei Thomas den Zweck, „der Gottesverehrung zu dienen“ 128. Deshalb müssen alle Sakramente in ihrer Relation zur Eucharistie verstanden werden, weil sie die finis, das Ziel und den Endpunkt aller Sakramente darstellt 129.
Bei Thomas ist Firmung als Sakrament des öffentlichen Bekenntnisses Christi deutlich auf die Taufe bezogen. Er unterscheidet schon im Sentenzenkommentar drei verschiedene Modi, nach denen aliquid spirituale im Empfang der Sakramente, die einen Charakter, ein Merkmal einprägen, übertragen wird. 1) „Uno modo ut aliquis in se spritualia participet“ 130. Dieser Modus wird in der Taufe übertragen, weil jeder Getaufte an eine spiritualis potentia passiva innehat, also beispielsweise die Vollmacht zum Empfang der Sakramente. 2) „Alio modo ut spiritualia quis in notitiam ducat per eorum fortem confessionem” 131. Dieser Modus sei in der Firmung gegeben und befähige zur Standhaftigkeit in Zeiten der Verfolgung, wozu Thomas die Legende des Heiligen Sebastian in Erinnerung ruft. 3) „Tertio modo ut etiam spiritualia credentibus tradat” 132. Dieser Modus ist in der Priesterweihe gegeben, die wie Taufe und Firmung auch einen geistlichen Charakter verleiht.
Thomas warnt ausdrücklich davor, sich aus Furcht dem Sakrament der Firmung zu entziehen 133. Taufe, Firmung und das Sakrament der Weihe werden bei ihm mit dem Priesteramt Christi verbunden 134. Der sakramentale Charakter, der in Taufe, Firmung und Priesterweihe übertragen wird, ist also auf eine jeweils eigene Art Teilnahme am Priesteramt Christi: „Im Gegensatz zum Taufcharakter, bei dem es sich um ein passives Vermögen zum Empfang der anderen Sakramente handele, werden Firm- und Weihecharakter vom Sentenzenkommentar als aktive Vollmachten ‚zur Ausspendung der Sakramente und zur Ausübung anderer heiliger hierarchischer Handlungen’ bezeichnet“ 135. Das bedeutet, dass die Sakramente auf die Eucharistie hin bezogen sind. Während die Taufe zum Empfang der Eucharistie berechtigt, ist die Firmung sowohl auf den Empfang der Eucharistie als auch auf die Sendung in der Eucharistie bezogen und das Sakrament der Weihe auf die Vollmacht zur Konsekration. Die Taufe gerät somit in den Bereich des persönlichen, des eigenen Heils, die Firmung erscheint als eine Beauftragung zum Kampf und zur Verkündigung 136. Diese aktive Komponente der Firmung wird allerdings durch eine passive ergänzt, wonach die Firmung – wie die Taufe – zum Empfang der Eucharistie befähige und diese vollende.
Ein ähnliches Verhältnis wechselseitigen Ergänzens und Oszillierens zwischen Aktivität und Passivität zeigt sich auch bei der gratia sacramentalis , die auf der einen Seite bei jedem Sakrament unterschieden sein soll, auf der anderen Seite aber immer die gratia sanctificans beinhalte 137. Dadurch löse Thomas von Aquin laut Adolf Adam das schwierige Verhältnis zwischen der Tauf- und der Firmgnade und die Frage nach der Steigerung der Taufgnade durch die Firmgnade 138:
„Durch die Taufe erfolgt eine gewisse Verähnlichung der Seelensubstanz mit dem göttlichen Sein und eine übernatürliche Stärkung der Seelenkräfte durch die mit der heiligmachenden Gnade verbundenen ‚virtutes et dona’. Dieses ‚gottähnliche’ Leben der Seele erfährt durch die spezielle Firmgnade eine Reifung und Vollendung, die auch verstärkend auf die ‚virtutes et dona’ wirkt. Gleichzeitig wird die im Getauften noch vorhandene Schwachheit geheilt und der Gefirmte zu den ihm übertragenen Aufgaben durch besondere Kräfte, deren Quelle die Passion Christi ist, befähigt. Diese Begnadung wird dem Heiligen Geist zugeeignet“ 139.
Thomas von Aquin bezeichnet die sacramentorum effectus ausdrücklich als „diversae medicinae peccati, et participationes virtutis dominicae passionis“ 140. Davon unterschieden sind nochmals die „diversae virtutes et diversa dona Spiritus sancti“ 141. Die Sakramente stehen somit bei Thomas in einem christologischen Begründungs- und Erklärungszusammenhang, die ihren Höhepunkt in der Theologie des Leidens und Sterbens Jesu Christi findet. Die Gaben des Heiligen Geistes sind auf verschiedene Handlungen der Christen und Christinnen hin ausgerichtet, weil in der Taufe bereits die Mitteilung des Heiligen Geistes gegeben ist. Von einem völligen Fehlen pneumatologischer Überlegungen in der Sakramententheologie Thomas’ zu sprechen, ist allerdings auch nicht korrekt, denn: „Baptismus aquae efficaciam habet a passione Christi, cui aliquis configuratur per Baptismum; et ulterius, sicut a prima causa, a spiritu sancto“ 142. Damit wird die Wirksamkeit der Taufe nicht nur von der Passion Jesu Christi abhängig gemacht, sondern auch vom Heiligen Geist. Allerdings entfaltet Thomas diese pneumatologische Dimension der Taufe nicht weiter und überträgt sie auch nicht explizit auf die Firmung. Aber die Firmung kann in der Theologie Thomas’ nicht ausschließlich und gegenüber der Taufe als das Sakrament des Heiligen Geistes verstanden werden.
Die Tauf- und die Firmgnade müssen nach Thomas als verschieden betrachtet werden, weil es sich um zwei verschiedene Sakramente handelt. Deshalb kann die Firmgnade die Taufgnade auch nicht in direkter Weise vollenden. Es gibt aber auch eine Gemeinsamkeit in der Gnade der Sakramente, so dass die Firmung die Gnade, die in der Taufe mitgegeben wurde, vermehrt 143. Dabei bleibt Thomas bei dem Vergleich der Ordnung der Sakramente mit dem natürlichen Leben eines Menschen. Die Geburt ist vergleichbar mit dem, was Adam „eine gewisse Verähnlichung der Seelensubstanz mit dem göttlichen Sein und eine übernatürliche Stärkung der Seelenkräfte“ 144genannt hat. Die Entwicklung des Menschen, die Thomas mit der perfectio in Verbindung bringt, ist vergleichbar mit der Reifung und Vollendung , die sich in der Firmung ereignet. Dass beide Sakramente in ihrem Verhältnis zur Passion Jesu und zum Sakrament der Eucharistie verstanden werden müssen, zeigt ihre innere Verbindung und das Ziel der perfectio, insofern sie das Ziel menschlichen Lebens darstellt: die Begegnung mit dem primus agens . Deshalb ist auch die spiritualis cognatio , die geistliche Verwandtschaft, nicht nur eine Wirkung der Firmung, wie Adam annimmt 145, sondern sie wird durch Taufe und Firmung verwirklicht 146, obwohl sie hauptsächlich im Eherecht thematisiert wird 147, denn sie stellt ein impedimentum dar 148. Die kirchliche Gemeinschaft ist demnach mit einer verwandtschaftlichen Beziehung vergleichbar, was sich auch daran zeigt, dass die Gläubigen in der Liturgie als Schwestern und Brüder angesprochen werden.
Читать дальше