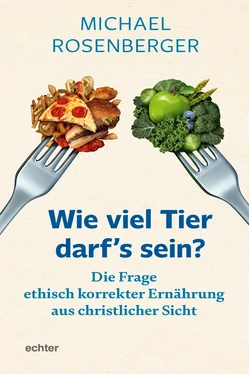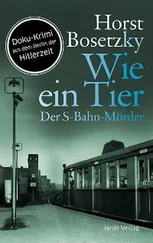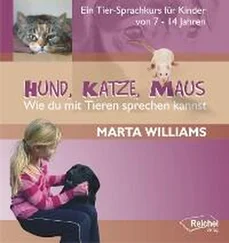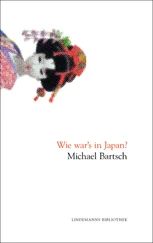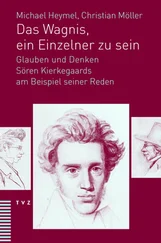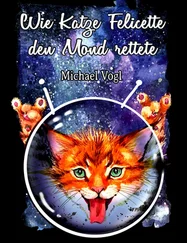Freilich gibt es auch den Gegentrend, der alle genannten Fortschritte konterkariert und ihre positiven Effekte zunichtemacht: Die überwältigende Mehrheit der KonsumentInnen zahlt auch weiterhin keine fairen Preise, sondern heizt durch ihr wählerisches Einkaufsverhalten einen Preiskampf an, wie er in keinem anderen Segment des Einzelhandels stattfindet. Dem Großteil der Bevölkerung sind Öko- und Bio-Produkte nur so lange erstrebenswert, wie sie nicht mehr kosten als konventionelle Lebensmittel. Und eine Mehrheit der Menschen isst nicht weniger, sondern mehr Fleisch, so dass der durchschnittliche Fleischkonsum in Deutschland unter dem Strich seit Jahren unverändert viel zu hoch ist.
Unter den genannten Aspekten einer ethisch reflektierten Ernährungspraxis wird die Frage des Fleischkonsums und des Verzehrs tierischer Produkte besonders heftig debattiert. Am Leiden der Tiere in der „Intensivtierhaltung“ erkennt der Laie am schnellsten, dass die vorherrschende Erzeugung der Lebensmittel viele Rücksichtslosigkeiten beinhaltet. Die Tiere sind schwächer und wehrloser als die schwächsten Menschen im landwirtschaftlichen System. Mit ihnen wird noch härter verfahren als mit SaisonarbeiterInnen während der Ernte und osteuropäischen LeiharbeiterInnen in den Großschlachtereien. Zugleich sind die Tiere leichter wahrnehmbar als die sogenannten Umweltmedien Boden, Luft und Wasser, die die Intensivlandwirtschaft ebenfalls massiv schädigt, und als die Biodiversität, die Lebensvielfalt, die sie stark bedroht.
Den Tieren sieht man das Unrecht sehr unmittelbar an, das ihnen im heutigen System unserer Lebensmittelerzeugung geschieht. Die Frage des Fleischkonsums und des Verzehrs tierischer Produkte soll daher im Mittelpunkt des vorliegenden Buchs stehen. Wie emotional sie mitunter debattiert wird, wird man da und dort in meinen Ausführungen erahnen. Viele LeserInnen werden das aber schon am eigenen Leib verspürt haben. Denn die einen, die auf den Konsum tierischer Produkte oder wenigstens auf Fleisch verzichten, bringen eine Menge persönliches Engagement ein. Sie verändern ihren Lebensstil in grundlegender Weise. Genau davor schrecken die anderen zurück und fühlen sich in ihren bisherigen Gewohnheiten bedroht.
Zwischen VeganerInnen auf der einen Seite und Fleischbergen auf der anderen steht also der nachdenkliche, noch nicht entschlossene Mensch und fragt sich, welche Seite Recht hat. Wohin führt der ethisch verantwortbare Weg unseres Umgangs mit den Tieren? Sollen wir weitermachen wie bisher? Müssen wir auf die Nutzung der Tiere in Zukunft gänzlich verzichten? Oder gibt es einen Weg der Mitte, der einschneidende Reformen in der Tierhaltung fordert, aber die vegane Ernährungsrevolution nicht für alle durchsetzen will?
2. Fleischverzehr als Identitätsfrage
Eine umfassende Ethik der Ernährung ist ein vielschichtiges und komplexes Ganzes. Das Christentum hat sich daher in seiner Lehre wie vermutlich alle großen Religionen auf einige Aspekte der Ernährungsethik konzentriert und diese durch die 2000 Jahre seiner Geschichte immer hochgehalten. Dazu gehören die Fragen maßvollen Essens und Trinkens, der wechselnden Zeiten von Fasten und Festen, der Gastfreundschaft gegenüber Fremden und Armen, der Solidarität mit den Hungernden. Von Anfang an verdrängt wurden hingegen Fragen des leiblichen Wohlergehens, der Lust und des Genusses von Essen und Trinken. Und schrittweise zurückgedrängt, wenn auch nie ganz vergessen, wurden Fragen des Fleischkonsums, die in der Anfangszeit des Christentums, wie wir noch sehen werden, eine prominente Rolle spielten, nach und nach aber an Bedeutung verloren.
Wie verhält sich das Christentum zum Fleischkonsum? Ist eine vegetarische oder gar vegane Ernährung christliche Pflicht? Ist sie umgekehrt vielleicht verwerflich, weil sie als alternative Heilslehre missverstanden werden kann? Gibt es womöglich, auch das wäre denkbar, eine völlige ethische Neutralität des christlichen Glaubens gegenüber Fleischverzehr und Fleischverzicht? Das ist die leitende Fragestellung dieses Buches. Auffallend ist dabei, dass das Christentum im kultischen Bereich nur vegane Lebensmittel verwendet: Brot, Wein und Pflanzenöl. Tierische Produkte haben (außer für die Armenspeisung) keinen Zugang zum Altar. Wir werden noch sehen, dass das eine Weichenstellung mit weitreichenden Folgen ist. Sie vollzieht sich im deutlichen Unterschied zum Judentum, das zur
Zeit Jesu im Jerusalemer Tempel zahllose Tiere opfert und auch nach dessen Zerstörung im Jahr 70 n. Chr. zumindest im Ritual des Paschamahls bis heute Lammfleisch und ein Ei verwendet.
Vegetarismus und Veganismus haben mittlerweile eine größere Bandbreite an Selbstverständnissen entwickelt. Bis vor wenigen Jahren praktizierten VegetarierInnen und VeganerInnen ihre Ernährungsweise praktisch immer im Kontext einer Weltanschauung. Sie drückten damit tiefgreifende Wertorientierungen aus. Im Zeitalter der Selbstdarstellung hat sich das gelockert. Heute sind Vegetarismus und Veganismus für manche Menschen Lifestyle statt Weltanschauung, Konvenienz statt Ethik, Selbstdarstellung statt Altruismus, Option statt Mission. Aber selbst dann geht es bei der Wahl einer fleischfreien oder gar tierproduktfreien Ernährung um mehr als nur die physische Materie tierischer Lebensmittel.
Ernährung ist symbolische Kommunikation und Interaktion. Über Essen und Trinken vermitteln wir einander verborgene Botschaften über unsere Werte und unseren Lebensstil. Im Essen und Trinken drücken wir uns selber aus: „Der Mensch ist, was er isst.“ 1Nur wenige Zitate werden so häufig verwendet und sind trotz ihrer Abnutzung so wahr. Die gesamte Identität des Menschen lässt sich an seinem Essen und Trinken erkennen. Denn im Essen und Trinken interagiert der Mensch – ganz gleich ob er allein oder in Gesellschaft ist – mit all jenen, zu denen er unmittelbar oder mittelbar Sozialbeziehungen besitzt – und das heißt mit allen Menschen. Die Ernährung ist Schlüsselmedium sozialer Beziehungen, Symbol für Identität und Differenz aller sich ernährenden Individuen. 2
Von daher ist es nur logisch, dass sich FleischesserInnen von VegetarierInnen und VeganerInnen und umgekehrt diese von FleischesserInnen in Frage gestellt, ja sogar angegriffen fühlen – allein dadurch, dass sie miteinander an einem Tisch essen. Fast zwangsläufig wird sich das Tischgespräch der im Raum stehenden Streitfrage zuwenden. Beide Gruppen fühlen sich genötigt, sich voreinander zu rechtfertigen. In diesem Zusammenhang stehen die vielen Witze über VegetarierInnen, von denen ich einige weniger aggressive zitieren möchte:
– Aus dem Leben eines Vegetariers: „Kinder, kommt zu Tisch, das Essen wird welk!“
– Wie nennt man einen dicken Vegetarier in Jugendsprache? – Biotonne.
– Auch die größten Vegetarier beißen nicht gerne ins Gras!
– Was ist der Unterschied zwischen einem Fleischesser und einem Vegetarier? Der Vegetarier stirbt gesünder! – Das Wort „Vegetarier“ kommt aus der Indianersprache und heißt „zu blöd zum Jagen“.
Nicht wenige Spottverse greifen die enge Beziehung zwischen Ernährung und Sexualität auf. Einige der harmloseren seien ebenfalls erwähnt:
– Vegetarier sind die, die Karotten lebendig und nackt ins Wasser werfen.
– Dürfen Vegetarier Schmetterlinge im Bauch haben?
– Platonische Liebe ist vegetarischer Sex!
Witze sagen mehr über die aus, die sie erzählen, als über die, von denen sie erzählen. Es sagt viel, dass Witze rund um das Thema Fleischverzehr alle nur in eine Richtung gehen. Wer Witze macht, fühlt sich angegriffen oder wenigstens in Frage gestellt. Wer die Eigenheiten des anderen akzeptiert, braucht über sie keine Witze machen.
Lebensmittel sind zu Lifestyle-Produkten geworden. Die methodisch leitende Perspektive dieses Buches wird daher die sein, was Fleischkonsum auf der einen und Fleischverzicht auf der anderen Seite über jene sagen, die dies als ihre Ernährungsoption wählen. Welche Identität geben sich Menschen, wenn sie eine Entscheidung für oder gegen tierische Produkte treffen? Denn letztlich geht es in Ethik und Religion immer um die Frage, wer man oder frau sein will.
Читать дальше