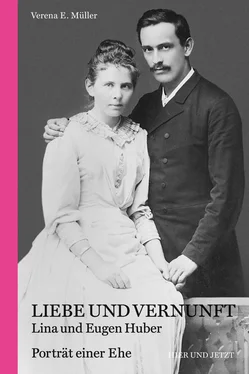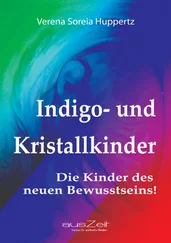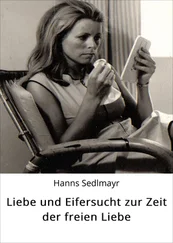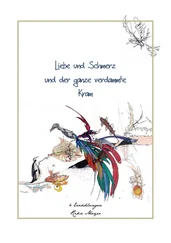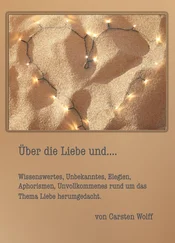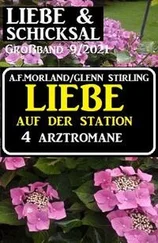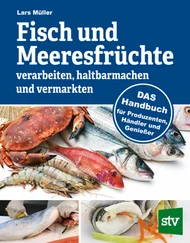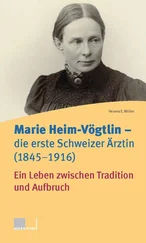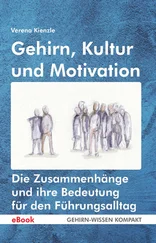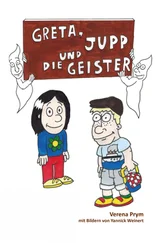1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Viele Interessen, die Huber im Gymnasium entwickelte, pflegte er bis zu seinem Tod. Sein Tagebuch beschreibt die Faszination des Schachspiels. «Das Schachspiel wird eifrig betrieben; ich siege zwar mit meinen Kameraden meistens; aber mit August geht’s schon schwerer; ich will ein Virtuos geben im Schach, wo möglich nämlich; es ist halt doch das schönste Spiel, das es gibt.» 17Mit August spielte er regelmässig, nach Hubers endgültiger Rückkehr in die Schweiz sogar auf dem Korrespondenzweg. Postkarten der Brüder, auf denen sie jeweils die einzelnen Züge festhielten, reisten zwischen Zürich und Bern hin und her. Auch mit einem ehemaligen Kollegen aus Halle, Rudolf Stammler, spielte er brieflich. 18Etwas blieb in all den Jahren konstant: Gegen wen auch immer Huber spielte, er verlor ungern.
«Oh, Mathematik und Geschichte, und Poesie! Das ist mir die Freude auf dem Lebensweg.» 19Ein paar Tage später wiederholte er im Tagebuch. «Das ist’s, was mich zur Mathematik hinzieht, diese herrliche Logik! Die Geschichte und Poesie sollen dann das Gleichgewicht erhalten gegenüber dieser Logik, für’s Gemüth.» 20Mathematische Probleme löste Huber zur Entspannung bis ins hohe Alter. Noch als 61-Jähriger wird er seufzen: «Ich bin unglücklicherweise wieder einmal unter eine mathematische Zwangsvorstellung geraten und habe heute längere Zeit die Lösung gesucht – statt gescheiteres zu tun.» 21
Mit knapp 18 Jahren war sich Huber sicher. «Ich kenne nun das Leben durch und durch … so kann ich hoffen, einstmals tüchtiger Jurist, Staatsmann und Dichter zu werden; wie ein Dante, ein Machiavelli oder so einer; ein Redner Thiers! 22Ah, das muss fein sein. So was zu werden!» 23«Mann sein und etwas Tüchtiges werden» ist ein Leitmotiv der Tagebucheinträge jener Zeit. Andererseits notiert er oft ein typisches Unbehagen. «Wieder Kämpfe – ich weiss nicht, was ich tun soll. In der Schule geht’s nicht wie’s sollte, zu Hause auch nicht, im Verein auch nicht; ich könnte mir die Haare ausraufen.» 24
Im Januar 1867 wurde Huber Mitglied des Gymnasialvereins, einer Art Debattierclub. Huber war es ein Anliegen, sich im Hinblick auf eine staatsmännische Laufbahn in Rhetorik zu schulen. Dieser Kreis gab ihm den Spitznamen Schwärmer. «Es muss was Schwärmerisches an mir hangen, und dieses Schwärmerische macht gerade meine schwache Seite aus», 25klagte er. Ein Höhepunkt seiner Schulzeit war die Aufführung von Schillers «Die Räuber» im Stadttheater 26am 21. Dezember 1867. Huber spielte den Karl Moor und verfasste für den Anlass einen Prolog. Erstmals wurde sein Name als Dichter in der Öffentlichkeit genannt. «Wenn’s einem so gut geht, so schreibt man weniger ins Tagebuch, wenn man dasselbe, wie ich, nur für Herzensergüsse braucht», 27konstatierte er befriedigt. Drei Jahre später erinnerte er sich. «Jahrestag der Räuber. Vieles anders. Ob besser?» 28Inzwischen war seine Mutter gestorben und er hatte zwei Studiensemester in Berlin absolviert.
Hubers Traum von einer literarischen Laufbahn ging ebenfalls auf die Gymnasialzeit zurück. In der Schule schrieb er einmal statt eines Aufsatzes ein Drama, las es vor, der Lehrer schmunzelte, die Klasse applaudierte «und ich war stolz und hochmütig». «Ich dichtete bald, weil ich wirklich so gestimmt war, bald, weil ich nun glaubte, ein Dichter werden zu müssen», 29schrieb er an Lina. Er verfasste ein neues Drama im Frühling 1864, vermutlich «Polycrates – Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen», 30dann einen langen Roman, den die Freunde sehr lobten, «Politisches Zeitgemälde aus der Schweiz anno 1839». 31Die Geschichte setzt sich mit der Epoche des Züriputsches auseinander. Sein Deutschlehrer, Pfarrer Spörri, war von dieser Produktion nicht eingenommen und noch im Alter beklagte sich Huber, dass er von ihm nicht verstanden und gefördert worden war. 32
Musik war eine weitere wichtige Leidenschaft Hubers, der er bis ins hohe Alter treu blieb. Zeit seines Lebens besuchte er regelmässig Konzerte. Wegen seines gelähmten Arms kamen für ihn nur wenige Instrumente in Frage. Er entschied sich für die Flöte. Huber muss es recht weit gebracht haben, denn Freund Schaggi lud ihn zu Besuch bei seinem Dienstherrn auf der Kyburg ein, «wobei auch deine Flöte ja nicht fehlen darf, die du so ausgezeichnet gut zu handhaben weisst». 33In vorgerücktem Alter hatte sich der Zustand seines Arms derart verschlechtert, dass Huber nicht mehr selbt spielen konnte. Auf Musik wollte er nicht verzichten, und er schaffte sich ein Aeolion, ein mechanisches, selbstspielendes Musikinstrument an, das er wenn nötig eigenhändig reparierte. Hausmusik bedeutete ihm viel.
Kurz vor der Maturitätsprüfung gerieten mehrere Schüler aus Hubers Klasse in schwerste Krisen. Im Januar 1868 wollte Ritter, später Arzt in Uster, die Schule verlassen. Der Rektor hielt ihn zurück und erliess ihm den Griechischunterricht. 34Im März plante Huber eine Flucht ins ägyptische Alexandria zu seiner Schwester Pauline. Er fing sich wieder auf, doch einige Monate später spitzte sich die Lage erneut zu: Kleiner und Huber wollten gemeinsam in den Tod gehen. War es Alfred Kleiners Idee? In Hubers Nachlass finden sich einige Abschiedsbriefe, aber wie es zu diesem fatalen Wunsch Hubers kam, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Typisch sind seine Worte an Freund Schaggi: «Das ist der letzte Akt des Trauerspieles! Der Kummer, meine Ideen für unmöglich, mich für zu schwach zu erkennen, erdrückt mich … Ich sterbe – mein Freund und ich – wir thuen uns den letzten Dienst.» 35Offenbar kam Huber als erster wieder zu Vernunft und musste sich von Freund Kleiner übel beschimpfen lassen.
Nach zwei Monaten bestanden beide die Maturitätsprüfung und nahmen ihr Studium an der Universität Zürich auf. Kleiner begann mit Medizin und schloss dieses Fach auch ab, zur Physik kam er erst danach. Huber geriet mit der Berufswahl in eine Notlage, wie er meinte. Er wählte Jurisprudenz, weil er sich vorstellte, «es werde mir hier am ehesten möglich sein, meine eigentlichen Pläne, für welche ich einzig mich begeistert fühlte, durchzusetzen, das waren meine Dichterpläne». 36
Im ersten Studiensemester verfasste Huber ein Versdrama in fünf Akten, «Der Landamman aus der March – Trauerspiel aus den letzten Tagen der alten Eidgenossenschaft». 37«Mit heiligem Schwur hatte ich gelobt, dieses Werk mit aller Reinheit meines Herzens zu beginnen, und hielt Wort.» Feierlich trug er in Zürchers Bude die Tragödie seinen Freunden Zürcher, Kleiner, Schröter und Heim vor. Sie waren nicht begeistert. «Mein Elend war grenzenlos. Ich war zu stolz, es zu zeigen, wie mich ihr Schweigen kränkte.» 38Die Geschichte hatte Jahrzehnte später ein Nachspiel. Beiläufig bemerkte 1917 Emil Zürcher bei einem Besuch in Bern, der «Landamman» habe ihm seinerzeit gefallen. 39Huber erinnerte sich, wie ihn der fehlende Beifall seiner Freunde, die Skepsis Professor Kinkels, 40dem er sein Werk offenbar gezeigt hatte, sowie die Bedenken der Mutter zu den Gesetzbüchern greifen liessen.
In der Familie erzählte man sich, Huber sei in jungen Jahren ein recht bequemer Bursche gewesen, der oft von seinem Bruder aus dem Bett gejagt werden musste, auf dass er pünktlich zum Unterricht erscheine. 41Hubers Alltag veränderte sich mit dem Übertritt an die Universität kaum. Die familiäre Überlieferung deckt sich mit Hubers Rückschau. «Ich habe diese Zeit übrigens auch in der Erinnerung als ein unglückliches Entwicklungsstadium. Ich war die ersten vier bis fünf Semester ein sehr unreifer Student. Erst mit dem Sommer 1871 wurde es besser, als ich meine Fusskrankheit herumschleppte und anfing zu lesen.» 42Schon während des Semesters 1872 in Wien dämmerte ihm allerdings die Einsicht, dass er allzu viel Zeit verloren hatte. «Zwei Semester gedichtet und spaziert, zwei mich getummelt und an Praxis gedacht, eines discutiert über Praxis und Politik, eines krank und elend, eines Arbeit – und nun, vor mir der Berg von Material, aus dem ich mein Wissen aufbauen soll!» 43
Читать дальше