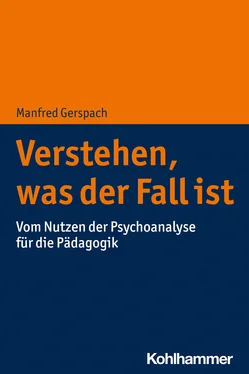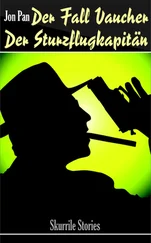Auf der Grundlage eines äußerst restringierten Wissenschaftsverständnisses wird die evidenzbasierte Forschung auf ein rein technisches und utilitaristisches Instrumentarium zurückgeschnitten. Die Kenntnis über das »What works« zielt allein noch auf überschaubare lineare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, was ausschließlich über experimentelle Forschungsdesigns sichergestellt werden soll. Buchholz bemängelt, dass das empirische Paradigma nur ein Teil wissenschaftlicher Bemühungen sei, sich »aber manchmal zur Illusion aufschwinge, über alles letzte Schiedsinstanz zu sein. Es steht jedoch nicht über, sondern neben anderen Paradigmen« (vgl. Buchholz 2006, S. 427).
Bei Lanwerd ist die Kritik so formuliert: Die englische Wendung »evidence-based zeigt den Wunsch nach der Vermessung des Beweisbaren«, während das Lateinische die Qualität dessen benennt, »was sich im Gegensatz zum logischen Beweis an das Unbeweisbare hält (…)« (vgl. Lanwerd 2019, S. 122). Damit fällt eine mit diesem Ansatz nicht kompatibel erscheinende forscherische Methodik per se aus der metaanalytischen Betrachtung heraus und kann dementsprechend auch nicht in die »Destillierung von Evidenz« Eingang finden (vgl. Koch 2016, S. 13.ff.). Das von der pädagogischen Wirklichkeit gezeichnete Bild »beruht auf Annäherungen und Vereinfachungen«, und was soll die Praxis überhaupt mit diesem Wissen anfangen (vgl. ebd., S. 19)? Im pädagogischen Feld ist über experimentelle, randomisierte kontrollierte Studien, womit der »goldene Standard« der Evidenzbasierung sichergestellt werden soll, die Qualität einer Aussage keineswegs zu garantieren (vgl. ebd., S. 14).
Instrumentelles Wissen ist sicherlich von sachdienlichem Gewicht, pädagogische Praxis muss aber zwingend noch aus weiteren Perspektiven beleuchtet werden. Anders als für die medizinische Überprüfung von Evidenz formuliert – und was auch dort immer wieder bloß eingeschränkte Erkenntnis erzeugt – treten in der Pädagogik mehrere Erschwernisse auf, die ein solches Unterfangen völlig ins Leere laufen lassen: »die Macht des komplexen Kontextes und seiner Einflüsse, die Allgegenwart von Interaktionen und die geringe ›Halbwertzeit‹ der Befunde (…)« (vgl. Koch 2016, S. 18). Weil sich die Erziehungswirklichkeit beständig ändert, verträgt sie eine derartige szientistische Amputation nicht (vgl. ebd., S. 13 ff.; Gerspach 2016b).
Mit der Unterscheidung in eine (sozialwissenschaftlich) sinnstrukturierte und eine (naturwissenschaftlich) nicht-sinnstrukturierte Welt belegt Hechler, dass die vom Menschen hervorgebrachte, durch Unbestimmtheit charakterisierte Veränderlichkeit ihm beständig Entscheidungen abverlangt.
»Diese Welt unterstellt menschlichem Erleben und Handeln grundlegende Sinnhaftigkeit. Der Mensch hat die Wahl und ist gezwungen zu wählen (…) und jeder Wahl laufen (…) Entscheidungsprozesse voraus, die sich eben nicht durch standardisierte Muster zu Wege bringen lassen (vgl. Hechler 2016, S. 45).
Hier setzt die »Erziehungskunst« ein, die sich durchaus auf empirische Befunde stützt, aber von einem Empirieverständnis gestützt wird, das sich keiner Evidenzbasierung unterordnen will. Indessen benötigen wir eine Fähigkeit, »in ungewissen erzieherischen Situationen eine grundlegende Situationssicherheit herzustellen« (vgl. ebd., S. 68).
»Die entwicklungspädagogischen Wissensbestände ermöglichen eben nicht nur ein pädagogisches Fallverstehen, sondern geben auch Hinweise auf die einzusetzenden erzieherischen Mittel (…)« (vgl. Hechler 2016, S. 46 ff.). Mit Bezug auf Freud, der sich fragte, ob »die Beschäftigung mit den uns vorgetragenen Wissenschaften oder die mit den Persönlichkeiten unserer Lehrer« dereinst stärker war (vgl. Freud, S. 1914f, S. 204), konstatiert Hechler, dass die »Person des Pädagogen (…) das wirksamste und am häufigsten verwendete Erziehungsmittel in der pädagogischen Praxis« ist (vgl. ebd., S. 71 f.). Damit biegt er auf die Zielgerade ein und thematisiert »die Bedeutung der Übertragung und Gegenübertragung im psychoanalytischen Verständnis« für die Ausgestaltung des »professionellen pädagogischen Wollens« (vgl. S. 74).
Somit sind wir wieder beim hermeneutischen Sinnverstehen, oder jetzt genauer: beim in der Psychoanalyse verwendeten Topos der Tiefenhermeneutik. Dieser Begriff geht auf Jürgen Habermas und Alfred Lorenzer zurück (vgl. Haubl, Schülein 2016, S. 194). Sie prägten ihn, um sich von einer eher philologisch ausgerichteten Hermeneutik abzugrenzen. »Die Tiefenhermeneutik (…) bezieht sich auf Texte, die Selbsttäuschungen des Autors anzeigen«, befindet Habermas (vgl. Habermas 1973b, S. 267). Und er sagt klipp und klar: »Die Psychoanalyse ist für uns als das einzige greifbare Beispiel einer methodisch Selbstreflexion in Anspruch nehmenden Wissenschaft relevant« (S. 262). Lorenzer wiederum spricht von der »Radikalisierung der Hermeneutikthese« durch die Psychoanalyse (vgl. Lorenzer 1974, S. 153), die sich selbst ihrer »vom Widerspruch bestimmten Eigenständigkeit« zu versichern habe. Der psychoanalytischen Kulturanalyse »als einer ›tiefenhermeneutischen‹« geht es um die Anerkennung einer eigenständigen Sinnebene unterhalb der bedeutungsgenerierenden Sinnebene sprachlicher Symbolik« (vgl. Lorenzer 1988a, S. 16 ff.).
Allerdings mag man noch so voller Enthusiasmus beteuern, dass die Psychoanalyse »auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Bedeutung und Faszination verloren« habe (vgl. Benecke u. a. 2016, S. 5). Oder gar einräumen, dass aus heutiger Sicht vieles, was dereinst geschrieben wurde, »ziemlich daneben liegt und erratisch wirkt« (vgl. Haubl, Schülein 2016, S. 188). All das zerstreut nicht die Bedenken, dass die Psychoanalyse von ihren Vertreter/innen gleichsam wie ein festes Gefüge von Glaubenssätzen idealisiert werde. Einmal abgesehen von dem affektgetränkten Duktus, mit dem diese Vorbehalte geäußert werden – was mich ein wenig stutzen lässt –, will mich auch der rationale Kern dieser Darlegung nicht überzeugen. Eine Disziplin, die sich dem Unbewussten nähert, wohl wissend, dass sie es nie wird à fond ergründen können, kennt den Zweifel als oberstes Grundprinzip. Ein Dogma aber ist doch genau dadurch gekennzeichnet, dass der Zweifel daraus kategorisch exkommuniziert ist.
Weil das Unbewusste an sämtlichen menschlichen Regungen beteiligt ist, fällt es der Psychoanalyse nicht schwer, ihren »disziplinären und professionellen Zugriff auf alle Ausdrucksgestalten der sinnstrukturierten Welt auszudehnen – es gibt sozusagen nichts, was nicht auf die Couch gelegt werden kann«. Überdies haben ihre theoretische Undurchdringbarkeit und »die Intimität ihrer Praxis« häufig zu verzerrten Vorstellungen Anlass gegeben (vgl. Hechler 219, S. 253 f.). Das ist aber kein Freibrief für eine kategorische Entrechtlichung der Psychoanalyse. Der Medizin-Nobelpreisträger Eric Kandel stellt einfach nur fest, dass »die Psychoanalyse immer noch die kohärenteste und intellektuell befriedigendste Sicht des Geistes darstellt« (vgl. Kandel 2006, S. 20; Hechler 2019, S. 247).
Wie dem auch sei. Jedenfalls hat es die Psychoanalytische Pädagogik jetzt doppelt schwer. Zum einen fristete sie schon immer ein eher randständiges Dasein im Kanon der Erziehungswissenschaften. Gemäß der neueren sozialwissenschaftlichen »Diskursanalyse« (vgl. Gardt 2007) repräsentiert sie als illegitimes Kind der Psychoanalyse eines jener in sich geschlossenen Theoreme, die den zeitgemäßen wissenschaftlichen Standards der Überprüfbarkeit nicht mehr genügen.
In seiner ernüchternden Bilanz der historischen Begegnung von Psychoanalyse und Pädagogik – die man im Sinne Martin Bubers eher als »Vergegnung« bezeichnen sollte (vgl. Buber 1986, S. 9) – gelangt Wininger am Ende zur Überzeugung, dass bis in die jüngste Zeit hinein psychoanalytische Theorien in »pädagogischen Veröffentlichungen teilweise eklektisch, enzyklopädisch und fragmentarisch rezipiert werden« (vgl. Wininger 2011, S. 273). Noch deutlicher wird das beim Durchblättern der Beiträge zum 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (vgl. van Ackeren u. a. 2020). In diesem über 600 Seiten umfassenden Reader musste ich lange suchen, bis ich auf psychoanalytische Perspektiven stieß (vgl. Rauh u. a. 2020). Und zu einem zweiten Text von Bühler, den es zu nennen gilt und der in seiner deutlichen Pointierung durchaus sympathisch daherkommt, würden mir zumindest einige kritische Anmerkungen einfallen. Seine Einschätzung der 1968er Jahre ist sehr auf »Nähe und Wärme« und die »steigenden therapeutischen Temperaturen der Pädagogik« fokussiert, das kritische Moment der Psychoanalyse bleibt dagegen eher blass (vgl. Bühler 2020, S. 605 ff.). Ansonsten wollte mir in ähnlicher Richtung nur noch Barbara Rendtorff begegnen, die in ihrem gemeinsamen Text mit Eva Breitenbach über Frauenbewegungen, Bildung und Erziehung aber eher mittelbar auf Psychoanalyse Bezug nimmt (vgl. Rendtorff, Breitenbach 2020). Allerdings hat sie sie sich an anderer Stelle dezidiert zum Verhältnis von Psychoanalyse, Geschlecht und Pädagogik geäußert (vgl. Rendtorff 2018).
Читать дальше