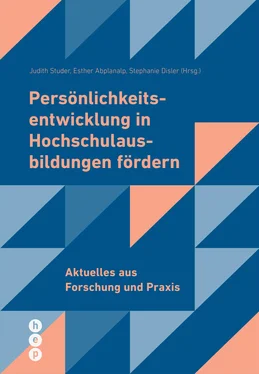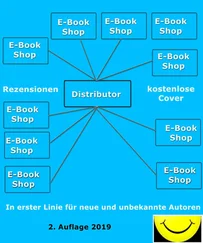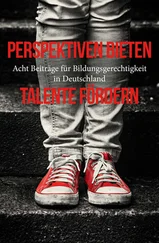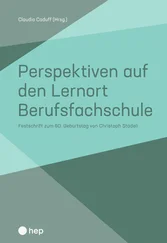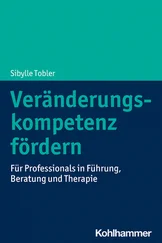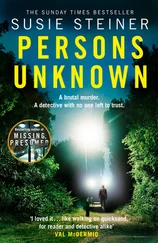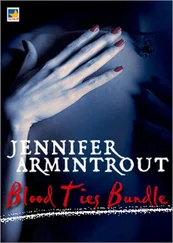Im Virtual Reality Lab des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule üben Studierende Beratungsgespräche mit virtuellen Klientinnen und Klienten. Esther Abplanalp und Manuel Bachmann präsentieren diese neue didaktische Lernumgebung und beschreiben erste Erfahrungen aus der Perspektive der Selbst- und Sozialkompetenzentwicklung.
Die aus der Ethnografie entlehnte Metapher der Expedition dient Manuel Freis als Möglichkeit, Praxiserfahrung von Studierenden kontextbezogen zu spezifizieren. Er beleuchtet die Potenziale eines metaphorischen Nachdenkens über die Erfahrungen aus dem Praxissemester und die damit einhergehenden Gelegenheiten zur Persönlichkeitsentwicklung im Studium.
Der Ausbildungssupervision, die in vielen Studiengängen als praktikumsbegleitendes Lernformat eingesetzt wird, widmet sich Tim Middendorf . Er thematisiert in seinem Artikel den Beitrag der Ausbildungssupervision zur Persönlichkeitsentwicklung im Studium der Sozialen Arbeit.
Der Phase des Bachelor-Abschlusses nimmt sich Elke Schimpf an. Am Beispiel eines ethnografischen Feldforschungsprojekts zeigt sie auf, inwiefern der Studienabschluss für Studierende ein Konfliktfeld und damit ein Nährboden für die eigene Persönlichkeitsentwicklung darstellen kann.
Mandy Schulze und Maria Kondratjuk gehen davon aus, dass Hochschullehre ein relationales Zusammenspiel von Lehren und Lernen ist. Sie nehmen einen Perspektivenwechsel vor und thematisieren die Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden aus der Sicht von Lehrenden.
Abschließend wirft Michael Stolle einen Blick in die Zukunft und zeigt auf, welche Schlüsselqualifikationen zukünftig gebraucht werden und welche Aufgabe dabei sogenannten Schlüsselqualifizierungseinrichtungen an Hochschulen zukommt. Dabei verortet er die Persönlichkeitsentwicklung im Kontext der digitalen Revolution.
Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre.
Bern, im Februar 2019
Die Herausgeberinnen
Judith Studer, Esther Abplanalp und Stephanie Disler
Stine Albers
Ein Plädoyer für personenbezogene Arbeit im Hochschulstudium
Abstract
Personenbezogene Arbeit ist eine anspruchsvolle und ebenso wichtige wie gewichtige Aufgabe im Hochschulstudium. Es handelt sich um eine Querschnittsaufgabe, die mit einer kritisch-reflexiven Auseinandersetzung von Studierenden mit theoretisch-fachwissenschaftlichen und beruflich-praxisorientierten Inhalten einhergeht. Personenbezogene Arbeit kann zur Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden im beruflichen Kontext beitragen. In diesem Artikel wird die Bedeutung personenbezogener Arbeit im Hochschulstudium aus bildungstheoretisch und psychoanalytisch orientierter sowie professionsorientierter Perspektive herausgearbeitet und begründet.
Personenbezogene Arbeit wird als eines von drei interdependenten Bezugssystemen im Hochschulstudium aufgefasst – neben einem theoretisch-wissenschaftlichen und einem auf die berufliche Praxis hin orientierten Bezugssystem (Albers, 2014, S. 115). Der Dimension «Person» scheint in dieser Triade bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden zu sein. So stellen Bayer, Carle und Wildt bereits 1997 für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung fest: «Gegenüber der Dominanz von Wissenschaft und Praxis als Bezugssysteme herkömmlicher Lehrerbildung ist der ‹Eigensinn› der Person in der Lehrerbildung zu behaupten» (a. a. O., S. 9). Fend (2009, S. 44) spricht von einer Doppelfunktion, die Bildungssystemen in der Moderne zukomme: die Reproduktion der Gesellschaft und das Werden der Persönlichkeit. Die bewusste Bezugnahme auf Letzteres erscheint im Rahmen des Hochschulstudiums noch ausbaufähig.
In diesem Artikel wird das Augenmerk auf ebendieses Bezugssystem «Person» gelegt. In einem ersten Schritt soll es um das Begriffsverständnis gehen, also um die Frage, wie personenbezogene Arbeit in diesem Beitrag ausgelegt wird. Daran schließen sich Begründungen an, warum personenbezogene Arbeit im Hochschulstudium für wichtig und gewichtig gehalten wird.
Arendt (2013 [1965]) differenziert zwischen «Mensch» und «Person». Sie schreibt der Person die Fähigkeit der Nachdenklichkeit zu, die wiederum die Entwicklung der Persönlichkeit einschließe.
«Ich erwähnte, dass das Person-Sein unterschieden wäre vom Nur-menschlich-Sein […] [und, d. Verf.] ich mich in diesem Denkprozess, in dem ich die spezifisch menschliche Differenz der Sprache aktualisiere, klar als Person konstituiere und dass ich Einer bleibe in dem Maße, in dem ich immer wieder und immer neu zu einer solchen Konstituierung fähig bin. Wenn es das ist, was wir gewöhnlich Persönlichkeit nennen […], dann ist sie das einfache, beinahe automatische Ergebnis von Nachdenklichkeit.» (A. a. O., S. 77 f.)
Luhmann (2002) weist darauf hin, dass sich zwar im Verlauf der langen Begriffsgeschichte verschiedene Varianten des Begriffs «Person» entwickelt hätten, mit Person aber immer etwas beschrieben werde, «was sich von der körperlichen Realisation des menschlichen Lebens und der bloßen Tatsache des Bewusstseins unterscheiden» (a. a. O., S. 29) lasse. Im vorliegenden Beitrag zeichnen sich Personen durch Reflexivität aus. Unter Reflexion wird in einem unspezifischen, allgemeinen Verständnis jede Art des rückbezüglichen Denkens, des Nach-Denkens verstanden. Erst eine kritische Reflexion fordert allerdings beim Reflexionsprozess explizit das eigene Selbst. Müller (2018b, 2018c u. a.) differenziert die Denkfiguren «Reflex», «Reflektion» und «Reflexion». Letztere wendet «die Ansätze von Reflex und Reflektion kritisch und nimmt sie in offenen, denk-, handlungs- und urteilserweiternden Varianten auf» (Müller, 2018b, S. 127). Die Denkfigur «Reflexion» berücksichtigt auch innerpsychische Prozesse. «So können sowohl äußere Relationsbeziehungen von Wechselwirkungen als auch innere Vermittlungsverhältnisse gedacht und konzeptualisiert werden» (ebd.).
Der Begriff «Person» wird verwendet, «um die gesamte physische und psychische Ausrüstung des Individuums zu bezeichnen» (Spiegel, 1961, S. 217). Das Selbst wird als psychischer Anteil aufgefasst, der dazu beiträgt, dass aus einem Menschen eine Person wird. Während sich zum Beispiel für Jacobson (1998 [1964]) das Selbst «auf die gesamte Person eines Individuums, einschließlich seines Körpers und seiner Körperteile, wie auch seiner psychischen Organisation und deren Teile» (a. a. O., S. 17) bezieht, wird im vorliegenden Beitrag zwischen «Person» und «Selbst» differenziert. Das Selbst als psychischer Anteil der Person kann wiederum als Prozess und Inhalt aufgefasst werden (Ludwig-Körner, 2014, S. 857 f.). In prozessorientierter Perspektive entwickelt und verändert sich das Selbst stetig. Eine inhaltlich-strukturorientierte Perspektive auf das Selbst betont das Beständige. Die Entwicklung der Persönlichkeit in Hinblick auf die Ausbildung konsistenter «Muster des Fühlens, Denkens und Verhaltens» (Pervin, Cervone & John, 2005, S. 31) wäre einer inhaltlich-strukturorientierten Perspektive auf das Selbst zuzuordnen.
Unter personenbezogener Arbeit wird die Berücksichtigung der Denkfigur «Reflexion» im Hochschulstudium verstanden. Reflexivität trägt wiederum zur Persönlichkeitsentwicklung bei – ein entscheidender Aspekt, wenn es im Folgenden um Begründungen für die Berücksichtigung personenbezogener Arbeit im Hochschulstudium geht.
Die Notwendigkeit personenbezogener Arbeit und die damit einhergehenden Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung sollen im Folgenden anhand von drei Perspektiven, die sich auf die Bildungstheorie, Psychoanalyse und Professionsforschung beziehen, herausgearbeitet werden.
Читать дальше