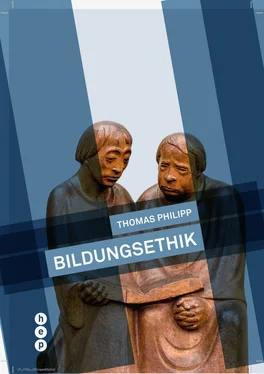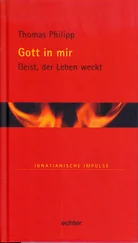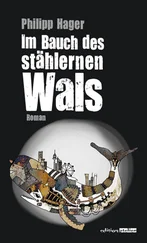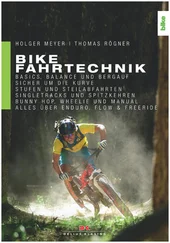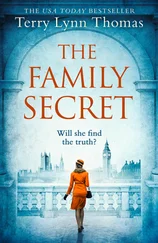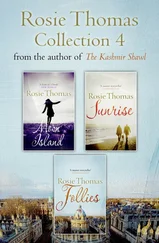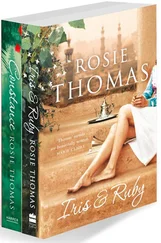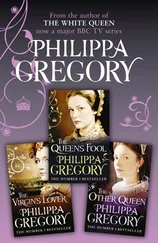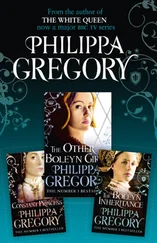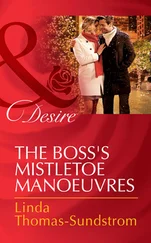Thomas Philipp - Bildungsethik (E-Book)
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Philipp - Bildungsethik (E-Book)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bildungsethik (E-Book)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bildungsethik (E-Book): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bildungsethik (E-Book)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wie soll ein junger Mensch sein? Verantwortungsvoll, einfühlsam, neugierig, kreativ, begeisterungsfähig und politisch gebildet? Nein. Heute zählt nur, was man messen kann. Fit für den Arbeitsmarkt reicht. Diese Entscheidung bedeutet, sich der Knechtschaft des dumpfen Funktionierens zu überlassen. Nur Selbstreflexion bietet einen Ausweg. Ein politischer Entwurf mit philosophischen Mitteln.
Bildungsethik (E-Book) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bildungsethik (E-Book)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Bildung sei stete Suche nach dem richtigen Ausdruck, unabschliessbar: Kein Sprechen genüge dem Richtigen. Immer sei neuer Fortschritt möglich. Bildung könne darum nie totalitär sein; Bildung und Macht widersprächen sich. Hieraus ergibt sich eine logisch zwingende Kritik der Reformen. «Im Bildungswesen findet heute ein Umbau statt. Das ‹Man› will keine Bildung mehr, sondern Kompetenz, auf die hin sich Qualifikationsprozesse selbst organisieren sollen. Von der Administration wird nicht mehr Vernunft und Einsicht bei Schülern, Lehrern, Schulleitung, Eltern angesprochen, sondern systemadäquates Verhalten erwartet. Das System setzt Ziele und prüft, ob die Ziele erreicht werden (nicht, ob sie als vernünftig akzeptiert werden ). Die Steuerung erfolgt über Zielvereinbarungen und Output-Kontrolle. Nicht mehr das berufsständige Wissen (pädagogische Grundsätze, Lehrpläne, Methoden) handelt argumentativ die Umsetzung des Richtigen aus, sondern durch die Kontrolle des Outputs (Erreichung von Qualitätszielen) wird Verhalten erzwungen. Es wird nicht mehr gefragt, ob pädagogisches Handeln in personalen Bezügen gelingt, sondern gemessen, ob der Output stimmt. Die Begründung wird durch die Messung ersetzt.
Auf der einen Seite überlässt man das System dem angeblich freien Markt. Wettbewerb von Schulen, öffentliches Ranking, selbständige Schule mit Leitbildentwicklung. Auf der anderen Seite wird der drohende Kontrollverlust der Verwaltung durch zentralistische Evaluation kompensiert. Autonomisierung meint in Wirklichkeit intelligente Steuerung. Eine Normierung und Vereinheitlichung bisher unbekannten Ausmasses wird als Freiheit deklariert. Eine um Bildung verkürzte ‹Bildungspolitik› ist Gewalt gegen Menschen.»
Ladenthin begreift Bildung schlüssig als lebendige Erfahrung. Das Wort gewinnt seinen Sinn nur aus der lebendigen Erfahrung des Ich. Hieraus ergibt sich seine politische Kritik. Auch dass Bildung dem Menschen zustösst, als Ereignis, sieht Ladenthin wunderbar klar: Obwohl es Denken nur als Selbstaktivität gebe, gerate der Mensch mehr in es hinein, als dass er es aktiv betreibe. Auch für das Ich sei Bildung nicht machbar. Es werde passiv gebildet durch die Zumutungen der Lebensgeschichte. 20
Bildungsqualen. Dieser Titel der Erziehungswissenschaftler Sandra Rademacher und Andreas Wernet drückt «diffuses Unbehagen an der Welt der Bildung» aus. Es sei «flächendeckend, weil das Spiel heillos unaufrichtig ist», bestimmt von «unkritische(r) Kritik, die Kritisierten und Kritikern gleichermassen zugutekommt». Letztere baden «in selbstgefällige(r) Attitüde des gegen-den Strom-Schwimmens». Ihre «Rolle ist im Drehbuch der Gesellschaft nicht die schlechteste. Sie beruht auf hintergründige(m) Agreement mit den Kritisierten; der vermeintliche Sand (wird) zum Schmiermittel». Die Reformpädagogen wüssten um ihren «kulturindustriellen Kitsch. Bei jeder Gelegenheit sind sie hinter der Bühne bereit, ihre Visionen bzw. diejenigen, die sie ernst nehmen, zu belächeln». Und die Technokraten «bestätigt die Kritik in ihrer Bedeutsamkeit», «sich in wohlwollender Herablassung gefallen(d)». Sie «wissen besser als ihre Kritiker, dass ihre Position politisch wie forschungslogisch auf Sand gebaut ist.»
Aufgabe der Erziehungswissenschaft wäre, den «Verblendungszusammenhang aufzudecken». Doch auch wo sie nicht in Betroffenheit, Weltverbesserung oder «intellektueller Servilität» gegenüber der Macht steckenbleibe, sei sie Teil des Syndroms. Der Einwurf der beiden Autoren lässt einen lichten Augenblick zu, der die Atmosphäre in Pädagogik und Erziehungswissenschaft wahrnimmt. 21Sie passt, so wird sich zeigen, genau in Habermas’ Analyse: die lebensweltliche Perspektive muss diffus bleiben, wo systemische Interessen sie ausbeuten. Denn ihr fehlen schon die Ressourcen, ihre Qualen klar wahrzunehmen.
«Sich bilden – das ist wie Aufwachen.» Der Philosoph Peter Bieri , der 2007 im Dissens über Bologna seine Professur niederlegte, sieht Selbstbestimmung des aufgeklärten Ich von aussen bedroht durch Manipulation, die ein Übel darstelle, weil das Selbstbild sie nicht kontrolliere. Sie entfremde vom Selbstbild und zerreisse das Ich. Die Person werde übergangen und verliere an Würde, etwa durch Werbung ohne Chance des Bemerkens oder taktisches Ausnutzen von Gefühlen. Aber «am tückischsten sind die unauffälligen Manipulationen durch akzeptierte Bilder, Metaphern und rhetorische Formeln. Es gibt Arten, über die Welt und uns Menschen zu reden, die jede Ausbildung eines eigenen, differenzierten Selbstbilds und selbstbestimmten Lebensstils verhindern. Fernsehen, Zeitungen und politische Reden sind voll davon, und es gibt jede Menge Mitläufer.» 22Dem könne das Ich nur die Selbstreflexion entgegensetzen, die stete Frage: Stimmt das eigentlich? Ist das recht beschrieben? Möchte ich in dieser Weise sehen und sprechen?
Auch von innen sei die Selbstbestimmung bedroht. «Erinnerungen können ein Kerker sein, wenn sie uns immer wieder überwältigen oder als verdrängte Vergangenheit unser Erleben aus tückischem Dunkel einschnüren. Wir können ihre Tyrannei nur brechen, wenn wir sie zu Wort kommen lassen. Als erzählte werden sie zu verständlichen Erinnerungen, denen wir nicht wehrlos ausgeliefert sind. Erinnerungen sind nicht frei verfügbar: Wir können ihr Entstehen nicht verhindern und sie nach Belieben löschen. In diesem Sinne sind wir als erinnernde Wesen keine selbstbestimmten Wesen.» Doch aufmerksames Zuhören könne dieses Fremde in ein zusammenhängendes Ich einbinden. Dazu genüge Wahrnehmen, nach Art der Esoterik, nicht. Hinzutreten müsse sprachliche Differenzierung. «Aus Gefühlschaos kann durch sprachliche Artikulation emotionale Bestimmtheit werden.» So gewinne das Ich die Initiative zurück. «Selbstbestimmt werden wir durch die Position des Verstehens: Indem wir ihre Wucht und Aufdringlichkeit als Ausdruck unserer seelischen Identität sehen lernen, verlieren die Erinnerungen den Geschmack der Fremdbestimmung und hören auf, uns als Gegner zu belagern.» Das Fremde werde sprachlich, gewinne Zusammenhang, gehöre nun zum Ich und seiner Geschichte. Die Kontinuität des sprachlichen Selbstbildes zu wahren, sei das Ziel des Menschen. «Das erzählerische Selbstbild lässt sich dann in die Zukunft fortschreiben. Um nicht von Tag zu Tag in die Zukunft hineinzustolpern, sondern Zukunft als etwas zu erleben, dem wir mit einem selbstbestimmten Entwurf begegnen, brauchen wir ein Bild von dem, was wir sind und was wir werden wollen – ein Bild, das in einem stimmigen Zusammenhang mit der Vergangenheit stehen muss, wie wir sie uns erzählen.» Selbstbestimmung sei nur als Integration des inneren Fremden möglich. 23
Im Zentrum steht das bewusste, kritische Ich der Aufklärung. Es sei sprachlich; in steter Auseinandersetzung müsse es sich selbst zusammenhalten. Bildung sei Selbstbestimmung, die sich gezielt in verschiedene Richtungen entfalte. «Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen: Man bildet sich . Ausbilden können uns andere; bilden kann jeder nur sich selbst. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können . Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden – wir streben danach, auf eine bestimmte Weise in der Welt zu sein.» 24
Die Selbstentfaltung fasst Bieri in neun Richtungen. «Bildung beginnt mit der Neugierde . Man töte die Neugierde, und man stiehlt die Chance, sich zu bilden. Neugierde ist der unersättliche Wunsch zu erfahren, was es alles gibt.» So entsteht Wissen in sprachlicher Gestalt. Naturereignisse, fremde Handlungen oder eigenes Erleben sind nur sprachlich verständlich. Zweitens sei Bildung aufgeklärtes Denken , dem «zwei Fragen zur zweiten Natur geworden sind: ‹Was genau heisst das?› Und: ‹Woher wissen wir, dass es so ist?›» Drittens das Bewusstsein der geschichtlichen Bedingtheit jedes Standpunkts. Sodann Lesen , Begegnung mit anderen Standpunkten, die zu einem genaueren, differenzierten Selbstbewusstsein führe. Fünftens Selbsterkenntnis , Auseinandersetzung mit intuitiv eingenommenen Positionen. Dann Selbstbestimmung durch Integration des inneren Fremden . Weiter moralische Sensibilität, Empathie : die Fähigkeit, den Standpunkt des anderen einzunehmen und darum etwas zu tun oder zu unterlassen. Achtens die Fähigkeit, Glück zu empfinden. «Niemand, der die Dichte solcher Augenblicke kennt, wird Bildung mit Ausbildung verwechseln und davon faseln, dass es bei Bildung darum gehe, uns ‹fit für die Zukunft› zu machen.» Schliesslich leidenschaftlicher Einsatz ; dem Gebildeten gehe es immer um alles. 25
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bildungsethik (E-Book)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bildungsethik (E-Book)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bildungsethik (E-Book)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.