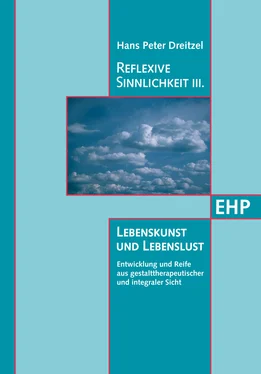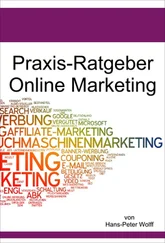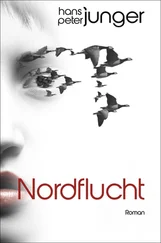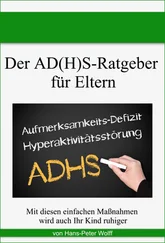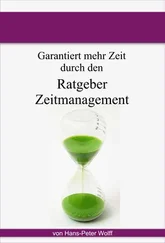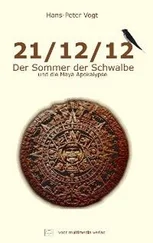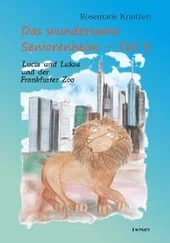Wenn es aber hier nun um die Frage nach dem guten Leben geht, nach der Kunst, das Leben so zu gestalten, dass es als ein sinnvolles erlebt werden und damit glücklich machen kann, dann bekommt dieser zentrale Gedanke meiner Überlegungen notwendigerweise eine ethische Dimension, die so in der Gestalttherapie als Praxis nicht enthalten ist – zu groß erschien den Gründern Frederik und Laura Perls und Paul Goodman die Gefahr, dass Wegweisungen als moralische Fremdkörper introjiziert werden könnten.
■ Dieses Buch aber enthält solche Wegweisungen – und ist deshalb kein gestalttherapeutisches Praxis-Buch! Dennoch wäre mir nichts unangenehmer, als wenn man es bei der verbreiteten Glücks- und Ratgeber-Literatur einordnen würde. Ich denke aber, dass es sich komplex genug darbietet, um nicht allzu leicht introjizierbar zu sein. Es will zum Nachdenken, Nachspüren, Ausprobieren und Üben anregen. Wäre es nur um praktische Tipps gegangen, wie man sein Leben lustvoller und reicher gestalten könnte, dann hätte ich mich zumindest ausführlich mit Erotik, Kulinarik und last not least mit dem Reisen befassen müssen, alles Bereiche, die der Kultivierung bedürfen und über die es eine reichhaltige Literatur kritisch zu besichtigen gilt. Hier geht es mir um die Umgestaltung des Lebens als ganzem durch die tiefgreifende Bewusstseinsveränderung, die unsere Epoche verlangt. Das geht nicht ohne Zumutung einiger Imperative.
Thomas Rieger, der die Idee zum Nachwort zu diesem Text hatte, meinte mit kritischer Freundlichkeit, es sei unter den apodiktischen Büchern das einzige, das er akzeptieren könne. Vielleicht liegt das daran, dass ich die Wirkung meiner Wegweisungen von der Übungspraxis der Leser abhängig mache; erst aus der Selbsterfahrung ihres Übens könnte sich der Sinn meiner Schlussfolgerungen auf je individuelle Weise erschließen. Diese im Druck eigens abgesetzten Schlussfolgerungen sind das Ergebnis meiner jeweils vorangestellten Überlegungen, aus denen sie sich begründen. Diese Übungspraxis wäre aber zugleich auch das Falsifikationsverfahren, dem ich mich nicht entziehen will. Auch meine ich, dass es nicht nur therapeutisches Lernen gibt, das in der Tat auf nichts als angeleiteter Selbsterfahrung beruhen sollte, sondern auch ein Lernen über das geschriebene und gesprochene Wort; das mag altmodisch sein, hat aber den Vorzug, dem Leser und Hörer die Integration oder das Verwerfen des Aufgenommenen zu überlassen.
Die im Text zitierten und im Literaturverzeichnis aufgeführten Texte wollen den Leser weder beeindrucken noch ermüden; sie sind nur als Hinweise für diejenigen Leser gedacht, die dieser oder jener Spur ihrer eigenen Neugier folgend weiter nachgehen möchten. Auch sind sie nicht vollständig genug, um als wissenschaftlicher Beleg für meine Thesen dienen zu können. Stattdessen sollen sie dem Leser zeigen, was die Quellen meines Denkens sind. Der Leser möge sie als einen Teller voller Lesefrüchte sehen, die ich auf dem Weg zu diesem Buch fand, und die mich angeregt und genährt haben – und koste sie nach eigener Lust und Neugier.
Dieses Buch wendet sich an Leser, die den ökonomisch relativ gesicherten Verhältnissen der sogenannten Westlichen Gesellschaften angehören. Denn was ein gutes Leben ist, kann nicht kontextfrei für alle Menschen die gleiche Gültigkeit haben; es ist abhängig vom ökonomischen Entwicklungsstadium der Gesellschaft, in der man lebt, sowie von der eigenen Klassenlage und dem eigenen kulturellen Milieu. Mit dieser Heterogenität müssen wir vorerst leben, denn die Weltgesellschaft ist erst im Entstehen. »Ich bin. Aber ich habe mich nicht: Darum werden wir erst«, wie Ernst Bloch hoffnungsvoll diesen Zustand auf anthropologischer Ebene beschrieb (E. Bloch, 1963, 11).
■ Wenn man heute jenseits der Biologie von Entwicklung spricht und damit anspielt auf zivilisatorische Prozesse der Differenzierung im Rahmen übergreifender, ganzheitlicher Systeme, steht man sogleich unter Verdacht, naiv zu verkennen, wie sehr sich in der Dialektik der Aufklärung (T. W. Adorno & M. Horkheimer, 1963) jedes positive Verständnis von Aufklärung selbst verbrannt hat. Zu schwer lastet die Erfahrung der Ungeheuerlichkeiten des XX. Jahrhundert auf uns, als dass wir noch ungebrochen unsere Hoffnungen auf das Wohltätige der Entwicklung von Technik und Wissenschaft setzen oder gar auf ein Fortschreiten der gesellschaftlichen Vernunft vertrauen könnten.
In diesem Buch stütze ich mich vor allem auf zwei Philosophen, Ken Wilber und Peter Sloterdijk, die sich diesem Verdacht zu entziehen suchen, beziehungsweise über ihn hinaus denken wollen. Wer heute über Entwicklung nachdenkt, kommt am Werk von Ken Wilber nicht vorbei. Wie kein Zweiter hat Wilber den Versuch unternommen, die verschiedenen vorliegenden Entwicklungstheorien systematisch zusammenzufassen, und damit eine Entwicklungsperspektive geschaffen, die es so seit Hegel nicht mehr gegeben hat. Vielleicht ist es die List der Vernunft, auf die Hegel im Zweifelsfall gern vertraute, dass Ken Wilber das Produkt einer Kultur ist, der man oft nachgesagt hat, dass ihr die Idee des Tragischen fremd sei. Sein Werk strahlt bei aller Vorsicht und Differenzierung einen ungebrochenen Optimismus aus, wie man ihn heute wohl nur noch in den USA und dort besonders westlich des Mississippi findet. Was man aus europäischer Sicht vielleicht als einen Mangel an differenziertem Geschichtsbewusstsein kritisieren würde, könnte sich als ein Glücksfall erweisen, denn Wilbers Entwicklungsdenken, so scheint es mir, findet aus der deprimierenden Beliebigkeit der Postmoderne heraus, ohne in die naiven Fortschrittshymnen des 19. Jahrhunderts zurückzufallen. Dazu trägt auch sein unerschrockener Versuch bei, endlich auch im Westen den Erkenntnisweg der subjektiven Selbsterforschung durch disziplinierte Formen der Meditation als eine legitime Form der hermeneutischen Erkenntnissuche zu etablieren. Wilber nennt seine Philosophie eine integrale Theorie, und das ist, worauf sich der Begriff integral im Untertitel dieses Buches bezieht.
Während der erste Teil des Buches sich hauptsächlich auf gestalttherapeutische Einsichten stützt, bezieht sich der zweite Teil eher auf Ken Wilbers integrale Entwicklungstheorie. Der dritte Teil des Buches dagegen verdankt sich letztlich meiner eigenen buddhistischen Lebenspraxis, die für mich stets eine Fortsetzung und Vertiefung der Achtsamkeitspraxis der Gestalttherapie war, in der ich ja nicht nur als Therapeut und Lehrer, sondern über dreißig Jahre hinweg auch als Lernender in zahlreichen Lehr-Workshops teilgenommen habe. Aber angeregt und ermutigt wurde ich zu diesem letzten Teil des Buches von Peter Sloterdijks Denken, insbesondere von seinem 2009 erschienenen Buch Du musst dein Leben ändern – Über Anthropotechnik. Es ist weniger die Fülle der Einzelanalysen als der Grundgedanke und der kühne Entwurf einer grundlegend neuen anthropologischen Perspektive, die mich überzeugt hat, den Menschen generell als ein übendes Wesen zu sehen.
■ Bleibender Hintergrund meines Denkens sind darüber hinaus bis heute meine Lehrjahre bei dem Philosophen Helmuth Plessner und bei dem Gestalttherapeuten Isadore From geblieben. Ihnen bin ich weiterhin zu Dank verpflichtet wie auch den vielen Kollegen und Supervisanden, mit denen ich im Laufe der Jahre arbeiten durfte. Wolfgang Kötter danke ich für die wiederholte energische Aufforderung, meine Gedanken zu diesem Thema zu Papier zu bringen, die mich sehr ermutigt hat, und ganz besonders auch für das Angebot, die letzte Korrektur des Manuskripts zu übernehmen Thomas Rieger danke ich für unsere Gespräche und sein Nachwort, das in seiner unverhohlenen, heute selten gewordenen, sozialistischen Perspektive einen spannenden Blick auf meine Gedankengänge wirft.
Ohne die Zusammenarbeit mit meiner Frau Brigitte Stelzer-Dreitzel gäbe es dieses Buch nicht.
Hans Peter Dreitzel
Читать дальше