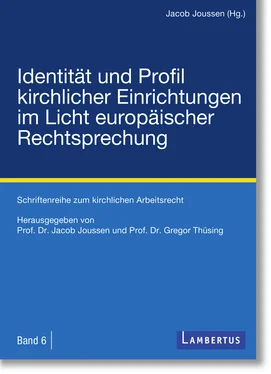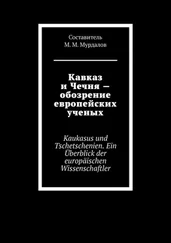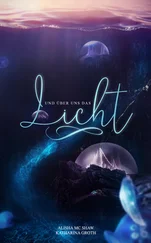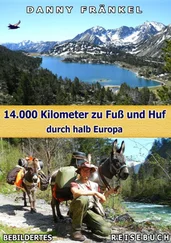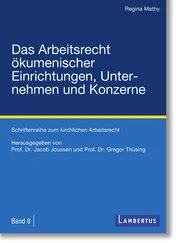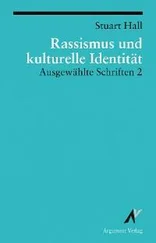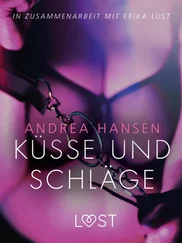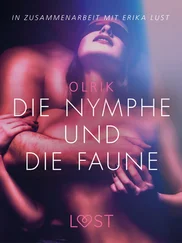Zusammenfassend kann man sagen, dass zwar die apodiktische Kürze der Ausführungen des EuGH kritikwürdig ist, nicht aber das Ergebnis der einschränkenden Auslegung von Art. 17 AEUV.
4. Verfassungsrechtliche Konsequenzen: Showdown in Karlsruhe?
Mit der Verfassungsbeschwerde im Verfahren Egenberger ist nun wieder das Bundesverfassungsgericht am Zug und in der Literatur wird – teilweise mit Verve – die Aktivierung der ultra-vires- und der Identitätskontrolle gefordert. 82Dass die vom Grundgesetz gezogenen Grenzen der Integration in die Europäische Union überschritten sein sollen, überzeugt allerdings nicht. Zu diesen Grenzen zählen ein dem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbares Schutzniveau bei den Grundrechten, die Einhaltung der Kompetenzgrenzen der EU und die Wahrung der Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten, zu der vor allem auch das Demokratieprinzip gehört. 83
Der vom EuGH hier gewährte Grundrechtsschutz ist dem des Grundgesetzes schon deswegen im Wesentlichen vergleichbar, weil beim kirchlichen Arbeitsrecht auf beiden Seiten Grundrechte betroffen sind, die der EuGH auch ausdrücklich benennt und in einen (jedenfalls nicht unvertretbaren) Ausgleich miteinander bringt. Ein Mehr an grundrechtlicher Freiheit der Arbeitnehmer bedeutet automatisch ein Weniger beim Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften. Und umgekehrt bedeutet größere Freiheit der Religionsgemeinschaften bei der Bestimmung der Anforderungen an die Tätigkeiten eben ein Weniger an grundrechtlicher Freiheit der Beschäftigten (etwa bei der Eheschließung oder auch der Religionsfreiheit). Hinzu kommt, dass der EuGH zu Recht die Notwendigkeit des effektiven Rechtsschutzes besonders betont. Dass am Ende die Entscheidung bei den staatlichen Gerichten liegen muss und das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften nicht zu einer Zauberformel für eine letztlich doch weitgehend freie Entscheidung der Religionsgemeinschaften werden darf, sollte außer Frage stehen und wurde auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in vergleichbaren Fällen eingefordert. Dem Vorwurf der „Richtertheologie“ 84ist deshalb zu entgegnen, dass umgekehrt eben auch die Gefahr einer „Theologisierung von Arbeitsbeziehungen“ in kirchennahen Einrichtungen besteht, bei der die Beschäftigten Rechtsschutzmöglichkeiten verlieren, die in allen anderen Bereichen als selbstverständlich angesehen werden. Mangelnden Grundrechtsschutz wird man dem EuGH deshalb kaum vorwerfen können.
Daneben wird die ultra vires-Kontrolle als einschlägig angesehen. 85Dass sich über die richtige Auslegung von Art. 17 AEUV trefflich streiten lässt, wurde bereits deutlich gemacht. Den Vorwurf der offensichtlichen Kompetenzüberschreitung 86wird man aber schon deshalb kaum erheben können, weil das vom EuGH zu Lasten der Bereichsausnahme favorisierte Abwägungsmodell in der deutschen Literatur zahlreiche Anhänger findet. 87
So bleiben am Ende die ganz schweren Geschütze der Verfassungsidentität und des Demokratieprinzips. Aber kann man ernsthaft behaupten, die hier betroffenen Teilaspekte des kirchlichen Arbeitsrechts seien unantastbarer Kern des Selbstbestimmungsrechts und damit möglicherweise Bestandteil der Identität des Grundgesetzes? Bei der Ausgestaltung der staatlichen Neutralitätspflicht in der Schule sah das Bundesverfassungsgericht in seiner ersten Kopftuch-Entscheidung auch unter dem Grundgesetz durchaus Raum für eine weniger religionsfreundliche Praxis. In der Entscheidung heißt es:
„Es mag […] auch gute Gründe dafür geben, der staatlichen Neutralitätspflicht im schulischen Bereich eine striktere und mehr als bisher distanzierende Bedeutung beizumessen und demgemäß auch durch das äußere Erscheinungsbild einer Lehrkraft vermittelte religiöse Bezüge von den Schülern grundsätzlich fern zu halten, um Konflikte mit Schülern, Eltern oder anderen Lehrkräften von vornherein zu vermeiden.“ 88
Wenn eine solche striktere Handhabung des Neutralitätsprinzips im Bereich der Schule durch den einfachen Gesetzgeber möglich ist, warum sollte sie dann beim kirchlichen Arbeitsrecht aus Gründen der Verfassungsidentität ausgeschlossen sein? Noch einmal: Was sich geändert hat, ist die Kontrolldichte. Unter dem strengeren Maßstab des EuGH wird es gerade bei der Durchsetzung von Loyalitätspflichten der eigenen Mitglieder (Anforderungen an die persönliche Lebensführung; Kirchenaustritt) geringere Sanktionierungsmöglichkeiten geben. Das wird für die karitativen und diakonischen Einrichtungen nicht immer einfach zu bewältigen sein. 89Aber auch nach dem Ansatz des Bundesverfassungsgerichts findet letztlich auf der zweiten Prüfungsstufe eine gerichtliche Kontrolle und Bewertung der von den Religionsgemeinschaften in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts beanspruchten Rechtspositionen statt. Deshalb handelt es sich bei den Vorgaben des EuGH aufs Ganze gesehen eben doch nur um eine (keine Frage: wichtige) Veränderung der Akzente, aber nicht um die behauptete „tektonische Verschiebung“ im Religionsverfassungsrecht, 90die man als Eingriff in die Verfassungsidentität des Grundgesetzes deuten könnte. 91
1BAG NZA 2019, 455; siehe zuvor EuGH Rs. C-414/16 (Egenberger), ECLI:EU:C.2018:257.
2BAG NZA 2019, 901 ff.; siehe zuvor EuGH Rs. C-68/17 (IR/JQ), ECLI:EU:C:2018:696; BVerfGE 137, 273; BAGE 139, 144.
3 https://praesident.diakonie.de/2019/03/22/diakonie-braucht-rechtssicherheit/#more-1925.
4Knapp zur Entwicklung statt anderer M. Ruffert/C. Walter , Institutionalisiertes Völkerrecht, 2. Aufl. München 2015, Rn. 550 ff.; ausführlich C. Grabenwarter/K. Pabel , Europäische Menschenrechtskonvention, 6. Aufl. München-Basel-Wien 2016, 41 ff.
5 H.M. Heinig , Religiöse Pluralität und religionsrechtliche Diversität als Topoi in der Rechtsprechung des EGMR, in: ders., Die Verfassung der Religion, 2014, 388 ff. (390 ff.); siehe ausführlich zu den unterschiedlichen Traditionen A. von Ungern-Sternberg , Religionsfreibeit in Europa, Tübingen 2008, 89 ff. und 151 ff.; siehe auch L. Friedner , Transformation of Church Relations – The Scandinavian Experienec, in: C. Walter/A. von Ungern-Sternberg (eds.), Transformation of Church and State Relations in Great Britain and Germany, Baden-Baden 2013, 85 ff.
6EGMR (GK), Appl. Nr. 44774/98, Urt. v. 10.11.2005 (Leyla Sahin), Rn. 109 ff.; EGMR (GK), Appl. Nr. 30814/06, Urt. v. 18.3.2011 (Lautsi), Rn. 61 f. und 68 ff.; EGMR (GK), Appl. Nr. 2330/09, Urt. v. 9.7.2013 (Sindicatul „Păstorul cel Bun“), Rn. 138; EGMR (GK), Appl. Nr. 43835/11, Urt. v. 1.7.2014 (S.A.S), Rn 129: „In matters of general policy, on which opinions within a democratic society may reasonably differ widely, the role of the domestic policy-maker should be given special weight […]. This is the case, in particular, where questions concerning the relationship between State and religions are at stake […]. As regards Article 9 of the Convention, the State should thus, in principle, be afforded a wide margin of appreciation in deciding whether and to what extent a limitation of the right to manifest one’s religion or beliefs is “necessary”.“; vgl. dazu C. Walter/M. Vordermayer , Verfassungsidentität als Instrument richterlicher Selbstbeschränkung in transnationalen Integrationsprozessen. Vergleichende Überlegungen anhand der Rechtsprechung von EuGH und EGMR, JöR 63 (2015), 129 ff. (158 f.).
7EGMR (GK), Appl. Nr. 43835/11, Urt. v. 1.7.2014 (S.A.S).
8EGMR (GK), Appl. Nr. 30814/06, Urt. v. 18.3.2011 (Lautsi).
9EGMR, Appl. Nr. 1620/03, Urt. v. 23. 9. 2010 (Schüth), Rn. 69; siehe im Übrigen EGMR, Appl. Nr. 425/03, Urt. v. 23. 9. 2010 (Obst), Rn. 49; EGMR, Appl. Nr. 18136/02, Urt. v. 3. 2. 2011 (Siebenhaar), Rn. 45.
10EGMR (GK), Appl. Nr. 56030/07, Urt. v. 12.6.2014 (Fernández Martínez).
Читать дальше