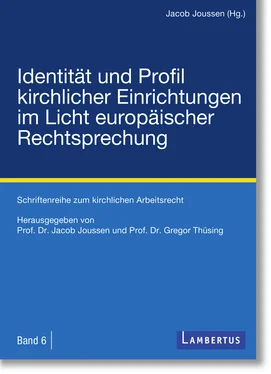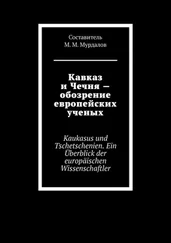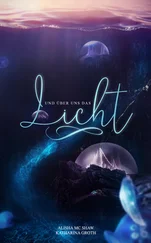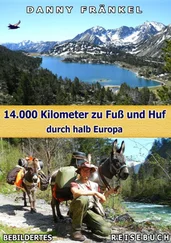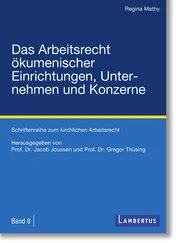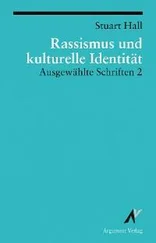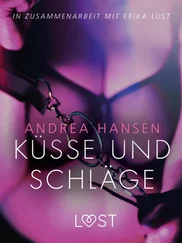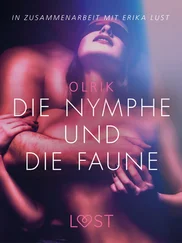3.2 Gerichtliche Überprüfbarkeit
Die Frage der gerichtlichen Überprüfbarkeit ist so eng mit dem Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften verknüpft, dass man von einer Dilemmasituation sprechen kann: Aus Gründen der Neutralität darf der Staat nicht darüber befinden, welche religiösen Anforderungen eine Religionsgemeinschaft an ihre Mitglieder stellt. Das wird besonders deutlich bei verhaltensbezogenen Anforderungen, wie etwa Bekleidungsvorschriften, Speiseregeln oder auch Vorgaben an eine gute Lebensführung im persönlichen Bereich, zu denen man die Beachtung einer bestehenden Ehe und auch ein Scheidungsverbot zählen kann. Über das Bestehen und den Umfang derartiger, oft unter dem Stichwort der „Loyalitätsobliegenheiten“ zusammengefasster Anforderungen kann nur die betreffende Religionsgemeinschaft selbst entscheiden. Dieser Hintergrund erklärt die auf Plausibilität beschränkte Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts auf der von ihm gesondert vorgenommenen ersten Prüfungsstufe. 64Gleichzeitig – und daraus resultiert das Dilemma – lässt sich eine Bewertung derartiger Anforderung durch staatliche Gerichte zumindest dann nicht vermeiden, wenn die Anforderungen nicht nur die private Lebensführung als solche betreffen, sondern zur Voraussetzung für die Einstellung gemacht werden. Das gleiche Problem stellt sich auch in Bezug auf die Mitgliedschaft als Einstellungskriterium.
Die Zweistufigkeitsdogmatik des Bundesverfassungsgerichts schichtet die gerade beschriebenen Probleme teilweise ab, indem sie die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts auf der ersten Stufe besonders herausstreicht. Gleichzeitig kaschiert sie aber in gewisser Weise auch das Dilemma, weil nicht mehr hinreichend deutlich wird, dass auf der zweiten Stufe auch nach der Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts eine Gewichtung der jeweiligen Interessen erforderlich wird, zu der dann auch eine Bewertung der von der Religionsgemeinschaft im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts geltend gemachten Positionen gehört. Es ist demnach auch unter der Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts keineswegs so, dass keine Kontrolle der im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts geltend gemachten Positionen durch die staatlichen Gerichte stattfände.
An dieser Stelle ist im Verfahren Egenberger vor dem EuGH offenbar durch die Begründung des Vorlagebeschlusses durch das BAG ein Missverständnis entstanden. Man kann die Begründung des BAG in seinem Vorlagebeschluss so verstehen, als ob die zweite Prüfungsstufe mit der intensiveren gerichtlichen Kontrolle nur in Kündigungsschutzprozessen zur Anwendung komme. 65Der Versuch einer Richtigstellung im Verfahren vor dem EuGH ist gescheitert, weil Generalanwalt und Gerichtshof sich – nachvollziehbar – auf den Standpunkt gestellt haben, der EuGH müsse seiner Entscheidung die Darstellung der Rechtslage durch das vorlegende Gericht zugrunde legen, weil er nicht selbst über die „richtige“ Darstellung des mitgliedstaatlichen Rechts entscheiden könne. 66Im Verfahren IR , bei dem es sich um einen Kündigungsschutzprozess handelte, spielte die Frage von vorneherein keine Rolle. 67
Die missverständliche Darstellung der Rechtslage in Deutschland ist sicherlich unglücklich. Sie dürfte aber letztlich weder für den Verfahrensausgang vor dem EuGH noch für die weitere Praxis entscheidend sein. Das gilt schon deshalb, weil der EuGH eben nicht über die deutsche Rechtslage entschieden hat, sondern nur über die unionsrechtlichen Vorgaben. Dabei legt der EuGH zugegebenermaßen einen starken Akzent auf das Erfordernis effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes. 68Das ist angesichts der Vorgaben in Art. 47 Grundrechte-Charta sowie Art. 9 und Art. 10 RL 2000/78 aber wenig überraschend. 69Hinzu kommt, dass auch der EGMR den Rechtsschutzaspekt besonders betont und dabei von strengeren Maßstäben ausgeht als sie in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts angenommen werden. 70Für die deutsche verfassungsrechtliche Dogmatik liegt in der Betonung des Rechtsschutzerfordernisses aber kein unüberwindliches Hindernis, da – wie gesehen – ohnehin auf der zweiten Prüfungsstufe auch gegenüber auf das Selbstbestimmungsrecht gestützten Entscheidungen von Religionsgemeinschaften Rechtsschutz gewährt werden muss. Im Ergebnis wird eine genauere gerichtliche Überprüfung angemahnt, nicht aber das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als tragende Säule des deutschen Religionsverfassungsrechts zum Einsturz gebracht. 71
3.3 Umgang mit Art. 17 AEUV
Die Entscheidung des EuGH wird in Bezug auf die Argumentation zu Art. 17 AEUV kritisiert. Dabei setzen die kritischen Stimmen unterschiedlich an. Auf einer sehr grundsätzlichen Ebene wird dem EuGH vorgeworfen, er habe mit seiner einschränkenden Auslegung die Grenzen des methodisch Zulässigen überschritten und damit ultra vires entschieden. Maßgeblich für diese Einschätzung sind vor allem die Entstehungsgeschichte der Norm und der Wortlaut, der das Verbot einer „Beeinträchtigung“ des Status von Kirchen und Religionsgemeinschaften enthält. 72 Claus Dieter Classen deutet die Norm zwar als negative Kompetenzregel, 73sieht die damit verbundenen Grenzen aber als durch die Entscheidungen in den Verfahren Egenberger und IR als gewahrt an, weil es an der zusätzlich erforderlichen Statusrelevanz fehle. 74 Jacob Joussen geht dagegen – gestützt auf andere Stimmen in der Literatur – davon aus, dass Art. 17 AEUV ein Abwägungsgebot begründe, bei dem der Achtung des Status der Kirchen in besonderer Weise Rechnung getragen werden müsse. 75
Was aber sagt der EuGH zu Art. 17 AEUV? In der Rechtssache Egenberger finden sich lediglich zwei Randnummern, die in der Tat wenig aussagekräftig sind. Die bloße Behauptung, der zeitliche Ablauf und der ausdrückliche Hinweis in den Erwägungsgründen auf die Vorläuferregelung in der Amsterdamer Kirchenerklärung sprächen dafür, „dass der Unionsgesetzgesetzgeber sie beim Erlass dieser Richtlinie und insbesondere ihres Art. 4 Abs. 2 berücksichtigt haben muss“ , ist sicherlich zu wenig. Als primärrechtliche Vorgabe wäre es notwendig gewesen, das Sekundärrecht inhaltlich an der Regelung in Art. 17 AEUV zu messen und nicht seine Beachtung durch den Unionsgesetzgeber zu unterstellen. Der insoweit erhobene Vorwurf einer Verkehrung der erforderlichen Prüfung in ihr Gegenteil ist gut nachvollziehbar. 76In IR begründet der EuGH seine Interpretation von Art. 17 AEUV wie in Egenberger und stellt sich auf den Standpunkt, die Regelung könne nicht bewirken, dass „die Einhaltung der in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/78 genannten Kriterien einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle entzogen wird.“ 77Diese Begründung ist erneut zu kursorisch, das Ergebnis wird aber in der Zusammenschau mit den Schlussanträgen von GA Tanchev in der Rechtssache Egenberger plausibel. GA Tanchev hatte dort argumentiert, dass eine Interpretation von Art. 17 AEUV im übergeordneten Rahmen des gesamten Unionsverfassungsrechts deutlich mache, dass Art. 17 AEUV nicht als „Metaprinzip“ im Sinne einer Bereichsausnahme für das mitgliedstaatliche Religionsrecht verstanden werden dürfe. 78Diese Herangehensweise überzeugt in Umfang und Ausführlichkeit der Argumentation und auch in der Sache. Weder aus der Entstehungsgeschichte noch aus dem Wortlaut lässt sich zwingend auf eine Bereichsausnahme schließen. 79Die Regelung sperrt damit nicht die Auswirkungen von Unionsrecht, das – wie das Antidiskriminierungsrecht – auf einem bestehenden anderen Kompetenztitel (für das Antidiskriminierungsrecht Art. 19 Abs. 1 AEUV) beruht und in den Bereich des Art. 17 AEUV hineinwirkt. GA Tanchev ist deshalb zuzustimmen, wenn er zum Abschluss seiner Analyse formuliert, dass Kollisionen unterschiedlicher primärrechtlicher Vorgaben durch Abwägung gelöst werden müssten, nicht aber durch eine hierarchische Vorrangregel. 80Im Übrigen ist es wenig überzeugend das gesamte kirchliche Arbeitsrecht dem von Art. 17 AEUV geschützten „Status“ von Religionsgemeinschaften nach innerstaatlichem Recht zuzuordnen. 81
Читать дальше