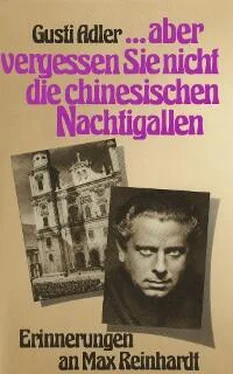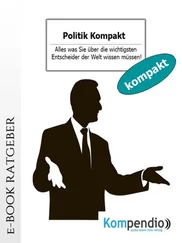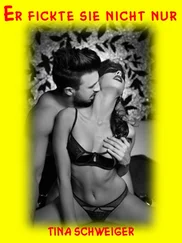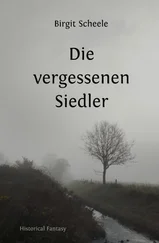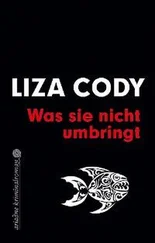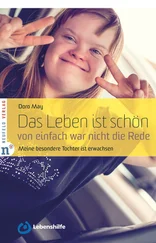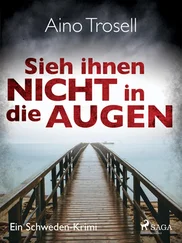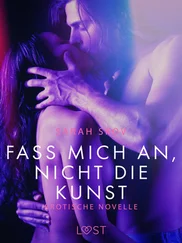Der Zug rollte hinaus in die herbstliche Landschaft, vorbei an Schönbrunn, das Max noch einmal wie ein Kindheitstraum grüßte, durch die hügelige Waldgegend, der Donau zu. Er sah das flache Land zwischen St. Pölten und Melk und dann das stolze Stift Melk, das herrliche Barockkloster. Der Zug hielt an den kleinsten Haltestellen. Reinhardt hat später oft gesagt, dass es immer gut sei, die Fahrt ins Glück im Bummelzug zu machen. Von dieser beseligenden Fahrt an habe er jede Sache, jeden Tag in diesem Tempo begonnen. Was er damals empfand, war reine Glückseligkeit. Es wäre schwer zu beschreiben, worin dieses Glück bestand. Er war ein armer, blutjunger Bursche, scheu, verschlossen, der nur wie zufällig in die Welt des Theaters geraten war, eine Welt, zu der er offenbar weniger passte als seine jungen Kollegen, die viel aufgeweckter, lebenstüchtiger, selbständiger, eleganter ausgestattet waren. Die Zukunft war ein verschlossenes Buch. 47 Jahre später schrieb Reinhardt darüber:
Alles war Dämmerung um mich. Trotzdem hielt ich, preßte ich in meinen Händen etwas zusammen, als ob es das Kostbarste gewesen wäre. Und es war es. Ein dunkler, unbestimmter, aber freudiger Wille, mit dem ich es schaffen wollte.
Das Zusammenpressen der Hände hat Reinhardt durchs Leben begleitet. Es blieb eine charakteristische Geste, wenn er alle seine Willenskräfte auf ein schwer erreichbares Ziel konzentrieren wollte. Die Bewegung des Zuges trug ihn. Im Rhythmus dieser Bewegung sprach er mit sich selbst. Dann sang er. Bauern stiegen ein und aus. Er sprach mit niemandem. Man stierte ihn an. Da ging er auf den Gang hinaus und blieb dort stehen. In der Dämmerung wuchsen Berge von beiden Seiten. Es ging höher hinauf. Auf den Gipfeln lag Schnee. Die Zeit wurde ihm nicht lang. Seine Gedanken liefen dem Zug voran. Die Wochen vor der Abreise waren voll Unruhe gewesen. Nun war er plötzlich in dieser Spanne allein, zwischen zwei Leben, konnte endlich über alles nachdenken, sich sammeln. Sein Herz war zum Zerspringen voll.
So kam der Abend. Jemand sagte: »Salzburg«. Stadt und Berge waren dicht verschleiert. Es regnete. Der Platz vor dem Bahnhof war dunkel. Im unbestimmten Licht weniger Laternen sah Reinhardt Menschen mit Regenschirmen und Regenfleck. Man wies ihn zur Pferdebahn. So zog er ein in die Stadt, von der Alexander von Humboldt sagte, dass sie neben Neapel und Konstantinopel die schönste der Welt sei. Die Pferdebahnfahrt schien ihm länger als die Eisenbahnreise. Vielleicht sah er durch angelaufene Scheiben einen Augenblick lang etwas vom Mirabellschloss, vielleicht am Makartplatz sogar von ferne das Theater, dem er so ungeduldig zustrebte. Dann ging es durch eine enge Straße endlich einem belebteren Platz zu, der in die Brücke mündet, die zwei Stadtteile verbindet. Hier musste er aussteigen. Vor ihm ragte ein uraltes Haus, der Gasthof Zum Stein, den man ihm empfohlen hatte. Freundliche Wirtsleute wiesen ihn über steile Steintreppen hinauf zu seinem Zimmer. Die Einrichtung des langen einfenstrigen Raumes war denkbar einfach: Bett, Schrank, Tisch, ein Waschtisch mit Krug und Wasserbecken. Er trat ans Fenster. Da strömte die Salzach vorbei, ein gelbaufgeregter Strom. Vom gegenüberliegenden Ufer schauten die Türme der Kirchen herüber, über der Festung hingen schwarzblaue, regenschwere Wolken. Es hielt ihn nicht im Zimmer. Hinter dem Gasthof führten enge Gassen bergaufwärts. Ahnungsvoll kam das Abendläuten von allen Kirchen der Stadt. Er sah zwischen dunklen Mauern die schönen Bäume an der Salzach. Es hatte zu regnen aufgehört. Als er zum Abendessen in den Gasthof zurückkam, fand er eine Botschaft des Theaters vor: er solle sich am nächsten Morgen zur Probe einfinden. Die Wirtsleute setzten sich an seinen Tisch. Von freundlicher Neugierde getrieben, verwickelten sie ihn in ein Gespräch und versuchten, Näheres über ihn zu erfahren. Das Essen war einfach, aber schmackhaft, die Wirtsstube gemütlich. Später wies ihm dann das flackernde Licht einer Kerze den Weg in sein Zimmer.
Als er früh aus einem tiefen Schlaf erwachte, hörte er vor allem das Rauschen der Salzach unter seinem Fenster. Ein wilder Fluss, der jeder Schifffahrt widerstrebt und die Stadt oft überschwemmt. Es war trüb, aber es regnete nicht mehr. Am Salzachufer schrien die Möwen. Menschen hasteten über die Brücke zum Rathaus hinüber. Das Theater war nur wenige Minuten vom Gasthof Zum Stein entfernt. Reinhardt konnte das neue Gebäude, dem er zustrebte, schon von weitem sehen.
Das alte k. k. Theater aus dem Jahr 1775 hatte 1892 dem Helmer- und Fellner-Bau weichen müssen. Unzerstörbar haftete trotzdem an dieser Stätte die Erinnerung an eine ruhmreiche Vergangenheit. Hier waren Ende des 18. Jahrhunderts Werke zeitgenössischer Dichter, Lessing, Goethe, Schiller, und auch Mozarts Opern aufgeführt worden. Shakespeares Lear und Tiecks Genoveva, Komödien von Iffland und Kotzebue standen im Repertoire. Emanuel Schikaneder kam mit seiner Truppe. Unter der Direktion Anton C. Lechner ward schließlich das alte Gebäude niedergerissen, und nun sollte das neue Haus am 1. Oktober 1893 mit einer Aufführung von Ludwig Fuldas Märchenstück Der Talisman eröffnet werden. Ein damals vielgespieltes, umstrittenes Werk: es war in diesem Jahr für den staatlichen Schillerpreis vorgeschlagen worden, aber Wilhelm II. hatte sich geweigert, dieser Ehrung seine Zustimmung zu geben. Es war in diesem Stück zu vieles, das wilhelminische Verlogenheit geißelte. Im Wiener Burgtheater wurde es 1892 aus Zensurgründen während der Proben abgesetzt.
Direktor Lechner, ein aufrechter, fortschrittlich gesinnter Mann, führte Regie bei seinem Eröffnungsstück Dem jungen Reinhardt hatte er für sein erstes Auftreten in Salzburg die Rolle des Oberfeldherrn Berengar zugeteilt. Es war keine große Rolle, aber die wenigen Szenen, in denen dieser Verschwörer auftrat, waren effektvoll und wichtig. Reinhardt war sich dessen bewusst, dass es nur ein Auftakt war und dass die Spielzeit ihm andere Aufgaben bescheren würde. So ging er an diesem Morgen mit größter Zuversicht und Vorfreude in das neue Haus. Alles spiegelte und glänzte verheißungsvoll. Gold dominierte in den barocken Verzierungen des Zuschauerraumes und Foyers und hob, zusammen mit dem Weiß der Stukkaturen, das festliche Rot der gepolsterten Sitze, der Teppiche und Wandbespannungen. Die Bühneneinrichtung war modern.
Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier waren in vollem Gange. Ein Fest-prolog und die Ouvertüre zu Titus von Mozart sollten der Vorstellung vorangehen. Die erste Talisman-Probe war für den nächsten Morgen angesetzt. Reinhardt lernte in seinem Direktor einen ausgesprochenen Kavalier kennen, dem er bis an sein Lebensende ein gutes Andenken bewahrte und von dem er noch nach vielen Jahren immer mit Verehrung sprach.
Als Reinhardt am folgenden Tag aus der Probe kam, schien die Sonne. Über der Salzach drüben lockte der Mönchsberg. Er fuhr mit dem Aufzug hinauf. Zum ersten Mal wurde ihm die ganze Herrlichkeit dieser Landschaft offenbar. Da war tief unter ihm die liebliche Stadt mit den vielen Türmen, mit den südlich flachen Dächern, Nonnberg, Gaisberg, Kapuzinerberg, die Festung, vom Untersberg überragt, die Bergkette zum Hohen Göll hinüber und im feinen Dunst darunter das flache Land. In diesem flachen Land lag ein See, dominiert von einem großen Schloss. Max Reinhardt ahnte damals nicht, dass dieses Schloss ihm einmal gehören, dass er dort zwei Jahrzehnte lang Gäste aus der ganzen Welt empfangen würde und dass der Weltruf der Stadt, auf die er hinabsah, von ihm begründet werden sollte. Und selbst hätte er es gewusst, es hätte ihn nicht glücklicher machen können, als er in diesen Stunden war. Die sanften Mönchsbergwiesen lagen in der warmen Herbstsonne wie ein Teppich vor ihm, Käfer summten, Schmetterlinge ließen sich vom Wind über das Gras tragen, durch die hohen Bäume in den Mulden zog manchmal wie ein Seufzer ein Windeswehen, und sein eigenes Herz schlug im Takt mit dieser herrlich schmetternden Ouvertüre zum Glück der Jugend, das so plötzlich über ihn hereingebrochen war.
Читать дальше