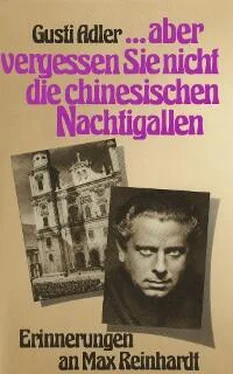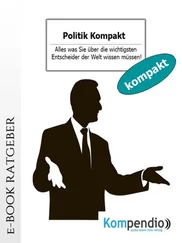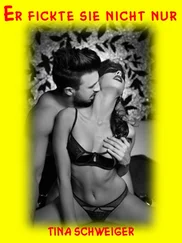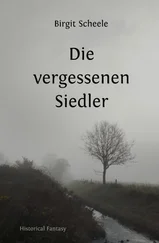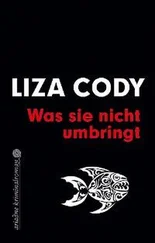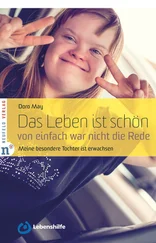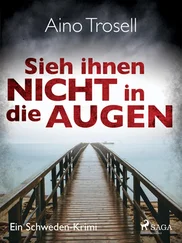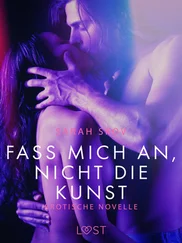Nur zu schnell hatte sich der Vorhang wieder geschlossen, und es sollte lange dauern, ehe er wieder aufgehen würde. Eine freudlose Schulzeit, quälend für ein phantasievolles Kind, zog sich durch die nächsten Jahre.
Max war der älteste von sieben Geschwistern. Die Verwandten seiner Mutter, sein Vater und dessen Brüder: alle waren wohlhabende Geschäftsleute. Viele Jahre hindurch hatten sie ein behagliches, sorgloses Bürgerdasein geführt. Nach 1870 geriet Österreich in finanzielle Krisen, die sich in dem Schicksal jedes einzelnen auswirkten. Infolge des Börsenkraches vom 9· Mai 1873 musste auch die Firma von Max Reinhardts Vater Konkurs anmelden. Man sah sich zu Einschränkungen gezwungen. Wilhelm Goldmann blickte sorgenvoll in die Zukunft. Vor allem galt es nun für seinen ältesten Sohn, nach Beendigung der Schulzeit einen Beruf zu finden. Es erschien ihm als ein großer Glücksfall, dass er Max in einer Bank unterbringen konnte. Diese Lehrzeit gehört wohl zu den härtesten Prüfungen, die Reinhardt je auferlegt wurden. Schwer lasteten auf ihm die Hoffnungen, die sein Vater in ihn setzte. Er liebte seinen Vater, die bedrängte Lage der Familie war ihm bewusst, aber die Leere dieser Tage war tödlich. Um diese Zeit hatte er das Theater entdeckt, und der Wunsch, selbst Schauspieler zu werden, beherrschte ihn. Er hat beschrieben, wie er seiner selbst zum ersten Mal bewusst wurde:
Ich war ein stiller, sehr scheuer Bub. An das erste Mal, wo ich, fast unbewußt, »aus mir herausging«, erinnere ich mich genau. Ich war auf einem Sängerfest im Prater – natürlich auf der Galerie. Plötzlich erschien der alte Kaiser. Der ganze Saal tobte und schrie vor Begeisterung. Und plötzlich, völlig erstaunt, hörte ich mich mitschreien und mitjubeln, hingerissen von der allgemeinen Aufregung und gänzlich ohne jede Scheu.
Er begann nun, soweit sein bescheidenes Einkommen es ihm erlaubte, auf Stehplätze ins Theater zu gehen. Er studierte Rollen, in einer Einsamkeit, die ihn erstickte. Ein Schauspieler ohne Zuschauer, ohne Echo … So war er, kaum der Schule entwachsen, in entscheidenden Jahren seiner Entwicklung, gehemmt, in eine Umgebung gezwängt, die ihm wesensfremd war, deren Plattheit ihn anwiderte, nicht imstande, die Pflichten, die ihm auferlegt waren, zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten zu erfüllen. Man beklagte sich über seine Zerstreutheit, sein verträumtes Wesen.
Der Familie Max Reinhardts war das Theater so fern wie der Mond. Sie wussten zwar, dass es aufleuchtet, wenn die Sonne untergeht – aber das war auch alles. Trotzdem waren sie geborene Zuschauer. Sein Vater, ein äußerst stiller Mensch, konnte wunderbar lachen. Er war sehr beliebt, wie alle guten Zuhörer. Die stärkste Persönlichkeit in diesem großen Familienkreis von Onkeln, Tanten, Nichten und Neffen war wohl Reinhardts Großvater. Er war überaus fromm, beinahe orthodox, und von einer einzigartigen ewigen Heiterkeit. Er betete immer. Wenn die Kinder zu ihm kamen, segnete er sie. Dabei war er völlig ausgeglichen und voll Humor. Fasttage waren für ihn strengstes Gesetz. Niemals aß er auswärts, selbst nicht bei seiner engsten Familie. Er wurde 98 Jahre alt, bis zu seinem Tode von seiner Tochter Julie betreut. Ihr Wesen war dem seinen diametral entgegengesetzt. Sie war in dieser stillen Familie die einzige, die vollkommen aus dem Rahmen fiel: ein Feuerbrand, eine Ekstatikerin. Ihre Reaktion auf kleinste Ereignisse war immer hochdramatisch. Sie war in ihrem Schmerz und in ihrer Freude höchster Steigerungen fähig. Sie war es auch, die seherhaft das Genie ihres Neffen Max erkannt und ihm die Erlaubnis seines Vaters erwirkt hatte, ihn Schauspieler werden zu lassen.
Bis in ihr hohes Alter zehrte sie noch an der stolzen Freude über diese Tat und erzählte immer wieder, mit der Dramatik, die ihr eignete, wie sich dieses Ereignis abgespielt hatte: Eines Tages begegnete sie ihrem Bruder Wilhelm, Reinhardts Vater, in der Alser Straße. Mit gesenktem Haupt ging er an ihr vorbei, ohne sie zu sehen. Sie hielt ihn an und fragte: »Was fehlt dir denn? Zählst du die Pflastersteine?« »Max macht mir Sorge«, erwiderte er. »Man ist unzufrieden mit ihm. Er ist zerstreut und lustlos bei seiner Arbeit.« Seine Schwester sagte: »Lass mich mit ihm sprechen.«
So kam es zu dieser Unterredung in der Wohnung der Eltern. Auf ihre Frage, was ihn bedrücke, antwortete Max: »Tante Julie, ich will Schauspieler werden.« Er gestand ihr auch, dass er schon seit einiger Zeit heimlich lerne.
»Willst du mir etwas vorsprechen?« Da habe sich Max, den sie immer nur als schüchternen, verschlossenen Jungen gekannt hatte, mit einem Schlag verändert: er stand vor ihr, mit blitzenden Augen, und eine Stimme, die sie noch nie gehört hatte, sprach aus ihm mit einer Leidenschaft, die sie erschütterte. Vergessen war alles: seine Zurückhaltung, sein bedrücktes Wesen. Marc Antons Rede füllte die Enge des Zimmers – sie wurde zu einer Fanfare, die ein Schicksal entschied. Tante Julie, deren Feuergeist ihm so nahe war, umarmte ihn. Vater und Großvater hatten im Nebenzimmer, das nur durch einen Vorhang getrennt war, zuerst erschrocken, dann ergriffen zugehört.
Reinhardts Vater ließ sich nun durch seine Schwester überzeugen, dass Max Schauspieler werden müsse. Max Reinhardt hat ihr das nie vergessen. Er hat sie bis zu ihrem Tode erhalten und immer getrachtet, ihr über schwere Zeiten, Krankheit und Wohnungsnot hinwegzuhelfen. Ihr Verständnis für ihn in seinen Jugendjahren entsprang wohl einer latenten schauspielerischen Begabung, die ihr angeboren war. Max Reinhardt hat oft darüber gesprochen und darin etwas gesehen, das ihm im tiefsten verwandt war. In zahllosen Briefen, die er im Abreisetrubel, vom Zuge oder vom Schiff aus schrieb, kehrt, mitten in grundlegenden Plänen für die nächste Saison, für Gastspiele und Verhandlungen, die Ermahnung immer wieder, sich während seiner Abwesenheit um Tante Julie zu kümmern und über ihr Wohlergehen zu berichten.
Reinhardt begann nun Unterricht zu nehmen. Bei einem Statisten namens Rudolf Perak. Ein Riesenkerl, ein Norddeutscher, der immer viele junge Menschen um sich versammelte, die er aus einem unerfindlichen Grund alle mit »Onkelchen« anredete. Er hatte seinen Schülern nichts zu geben. Ihm selbst war es nie geglückt, eine Rolle zu spielen …
Reinhardt hat nur einen Lehrmeister gehabt: das alte Burgtheater. Er hat über diese Lehrzeit oft gesprochen und auch darüber geschrieben:
Ich bin auf der vierten Galerie geboren. Dort erblickte ich zum ersten Mal das Licht der Bühne, dort wurde ich genährt (für 4o Kr. altösterreichischer Währung pro Abend) mit den reichen Kunstmitteln des Kaiserlich-Königlichen Instituts, und dort sangen an meiner Wiege die berühmten Schauspieler jener Zeit ihre klassischen Sprecharien. Ich könnte ihre wunderbaren Tonfälle noch heute aus dem Gedächtnis aufzeichnen, wenn es für die Melodie des Sprechens allgemein gültige Notenzeichen gäbe. Das Burgtheater war voll von Stimmen, die wie alte kostbare Instrumente ein unvergleichlich abgetöntes Orchester bildeten. Der Klang kam aus weiter Ferne zu uns, die wir da oben auf dem höchsten Gipfel des Hauses zusammengepreßt standen. Die Worte waren von Shakespeare, Molière, Goethe, Schiller, Calderon, Grillparzer. Wir kannten die Stücke auswendig, aber man konnte alles immer wieder hören und sehen, wie man die Fünfte oder die Neunte Symphonie von Beethoven, Bach, Mozart immer wieder hören kann. Es waren gar nicht die großen Tiraden, sondern ganz einfache Sätze, in denen die stärksten Melodien lagen. Wer sollte glauben, daß ein schmuckloser Satz wie: »Max, bleibe bei mir« in Wallenstein, oder: »Seid Ihr auch wohl, Vater?« eine so tiefe Wirkung ausüben konnten? und doch wußten wir alle, wie Sonnenthal (als Wallenstein) und Lewinsky (als Franz Moor) diese Worte sprachen. Wir kannten nicht nur den Text, wir kannten die Schauspieler auswendig.
Читать дальше