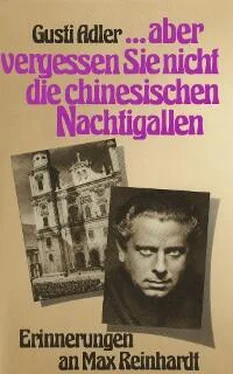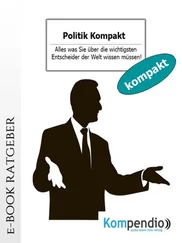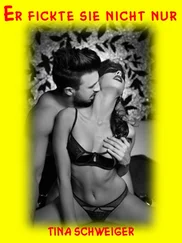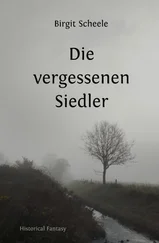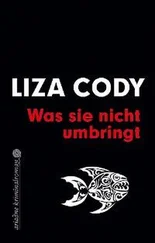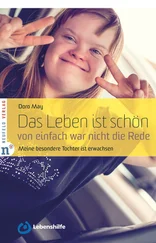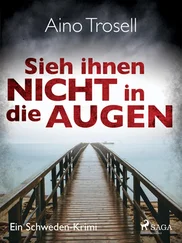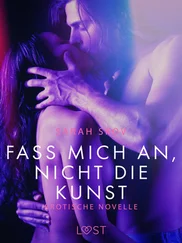Gusti Adler - ...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.
Здесь есть возможность читать онлайн «Gusti Adler - ...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen. — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Max Reinhardt hatte zuletzt 1911 in Skandinavien mit Ödipus gastiert. Diesmal, im November 1915, brachte er Die Räuber, Faust, Sommernachtstraum, Was ihr wollt, Minna von Barnhelm und Strindbergs Totentanz nach Stockholm und Christiania. Er wurde jubelnd empfangen. Nordische Kunst verdankte ihm sehr viel. Als Regisseur und vorher als Schauspieler. Seine Inszenierungen hatten aus den Tiefen der Werke von Ibsen, Strindberg, Björnson, Hamsun ungeahnte Schätze gehoben. Maler wie vornehmlich Edvard Munch hatte er herangezogen, um einen Bühnenraum zu schaffen, der die Wirkung noch steigerte. Unvergessen war aber auch der Schauspieler Reinhardt in Ibsenrollen, wie etwa Foldal oder Engstrand. Ihm selbst war die Kunst nordischer Schauspieler sehr ans Herz gewachsen. Er versäumte niemals, Vorstellungen in Stockholm, Christiania oder Kopenhagen beizuwohnen, und wenn er mit skandinavischen Schauspielern arbeitete, waren ihre feinen Nuancierungen, das Sparsame verhaltener Leidenschaft (das freilich in vielen Fällen nur vom Regietisch, von der Bühne aus, genossen werden konnte), ein besonderes Fest für ihn.
Auf dieser Nordland-Tournee verfolgte Reinhardt noch ein anderes Ziel. Die tänzerische Begabung dänischer und norwegischer Künstler war ihm seit Jahren bekannt. So hoffte er, in Skandinavien Tänzer für ein Ballett-Ensemble zu finden, das, für Berlin neu, in Tanzspielen das Repertoire seiner Berliner Theater beleben sollte. Von der Stockholmer Oper wurde ihm ein Saal zur Verfügung gestellt. Dort konnten Kandidatinnen vortanzen. Aber erst in Christiania kam es zu einer entscheidenden Begegnung: Lillebil Christensen und ihre Mutter Gydda Christensen. Lillebil debütierte später im Deutschen Theater als Prinzessin Fay-yen in Hofmannsthals Tanzspiel Die Grüne Flöte.
Bei seiner Rückkehr nach Berlin fand Max Reinhardt verschärfte Kriegszustände vor. Der Gegensatz musste nach den Wochen im neutralen kriegsfernen Ausland doppelt fühlbar sein. Die Polizeistunde war auf halb zwölf verlegt worden. Das bedeutete früheres Schließen der Theater, da der Nachtverkehr auf Straßenbahn, Hoch- und Untergrundbahn ebenfalls um anderthalb Stunden verkürzt worden war. Rationierungen erschwerten die Anschaffung von Dekorationen und Kostümen. Aber trotzdem war die Stimmung im Hinterland noch immer gut. Beim Fall von Bukarest dröhnten Salutschüsse über der Stadt, die Häuser waren beflaggt, und alle Glocken läuteten. Noch schlug man Brücken in eine glücklichere Zukunft: ein »Haus der Freundschaft« sollte in Konstantinopel errichtet werden. Peter Behrens, Hans Poelzig, Bruno Paul und andere, wenn auch minder bedeutende Architekten nahmen an dem Wettbewerb teil. Und noch blieb die Freude am Theater von den Einschränkungen unberührt. Der Andrang des theaterhungrigen Publikums wuchs in solchem Ausmaß, dass sich Reinhardts Deutsches Theater und die Kammerspiele als unzulänglich erwiesen. Die Volksbühne am Bülowplatz war 1914 eröffnet worden. Von Oskar Kaufmann gebaut und mit allen, damals neuen, Errungenschaften der Bühnentechnik ausgestattet. Ein Haus, das mit seiner warmen dunkelbraunen Mahagonitäfelung einen würdigen Rahmen für Reinhardts Inszenierungen bot. Verhandlungen mit der Neuen Freien Volksbühne führten März 1915 zum Abschluss eines zweijährigen Pachtvertrages, und die Übernahme erfolgte am 1. September 1915.
Die kurzen Sommerferien, die sich Reinhardt gönnte, verbrachte er in Hiddensee. Dort arbeitete er an seinem Regiebuch für Shakespeares Sturm für die Volksbühne. Er liebte das Meer, den Strand, Sonne und Wind. Ob er nun im Norden, am Mittelmeer oder in Kalifornien war: immer suchte er nach Häusern in der Nähe des Ozeans, immer ging er viele Stunden dem Wasser entlang im Sand. So begleitete das Rauschen von Wind und Brandung seine Arbeit an dem Regiebuch in den Nächten von Hiddensee.
Wieder schuf Ernst Stern den Bühnenrahmen, Humperdinck die Musik. Trotz der glänzenden Besetzung – Ludwig Wüllner, Rudolf Schildkraut, Maria Fein, Camilla Eibenschütz, Katta Sterna – konnte diese erste Inszenierung Reinhardts in der Volksbühne das dortige Publikum nicht sofort vollkommen erobern. Instrument und Zuhörer müssen aufeinander abgestimmt sein. Erst spätere Aufführungen brachten diesen Einklang. Viele der Repertoirestücke des Deutschen Theaters wurden in die Volksbühne verpflanzt. Die Räuber, Der Kaufmann von Venedig, Ödipus wurden dort gegeben, neben Gerhart Hauptmanns Werken und Schönherrs Volk in Not.
Shakespeare-Zyklus – Deutscher Zyklus –
Probenarbeit
1916: Shakespeares 300. Todestag. Ein äußerer Anlass für Reinhardts Shakespeare-Zyklus. Seine innerste Andacht zu dem Werke Shakespeares war nicht an ein Datum gebunden. Er hat sie mit glühender Liebe, wie eine nie verlöschende Fackel, sein Leben hindurch bis zu seinem Tode getragen. Vom Sommernachtstraum (1905) angefangen, durch Städte und Länder, auf große und kleinste Bühnen (München), auf Freilichtbühnen (Florenz, Boboli-Gärten; Oxford; Schloss Kleßheim bei Salzburg; Hollywood Bowl), immer lebendig, vertieft mit zunehmenden Jahren, durchleuchtet, in ewigem Fließen wie das Leben selbst.
Im Wilhelminischen Zeitalter hatten die Klassiker, und vor allem Shakespeare, etwas von Herbariumpflanzen. Sorgfältig gepresst, des Lebenssaftes beraubt, vom Publikum mit ehrfürchtiger Langweile betrachtet. Max Reinhardt brachte sie wieder zum Blühen, entriss sie der Gruft, in der sie verdorrt waren. Unter seiner Direktion des Deutschen Theaters allein legen über 2000 Shakespeare-Aufführungen in den ersten 25 Jahren Zeugenschaft dafür ab. Dazu gesellen sich noch zahllose Aufführungen in späteren Jahren und in allen anderen Theatern der Welt, in die er Shakespeares Ruhm trug.
So war der Shakespeare-Zyklus, den er schon 1913 und 1914 begann, nur ein Glied in einer Kette, die längst in seinem Herzen und bei seinem Publikum verankert war. Trotzdem gab es noch immer Steigerungen. Seine Macbeth-Aufführung im Jahre 1916 übertraf alles, was ihr vorangegangen war. Die Fülle der Gestalten zog vorüber, litt, kämpfte und riss Erleben und Begreifen ganz in ihren Kreis. Im Mittelpunkt dieses Kreises, treibend, bewegend, wie giftige Pflanzen, Macbeth und die Lady, hemmungslos, triebhaft. Was Reinhardt hier aus Paul Wegener, Bruno Decarli, Hermine Körner und einem ebenbürtigen Ensemble herausholte, war einmalig. Gleichsam ein Spiel mit lebendigen Schachfiguren, deren Schicksal vom ersten Zuge an vorausbestimmt, mit unerbittlicher Folgerichtigkeit dem vernichtenden Ende zuschritt. Ernst Stern hatte die Dekorationen geschaffen, die in ihrer dunklen Wucht, in ihrem flammenden Rot wie eine stumme Anklage hinter dem Mord standen.
Elf andere Shakespeare-Werke waren Macbeth vorangegangen. Darunter Hamlet, Othello, beide Teile König Heinrich IV., Romeo und Julia, Der Kaufmann von Venedig, Was ihr wollt, Viel Lärm um nichts – alle in Glanzbesetzungen, mit Albert Bassermann, Alexander Moissi, Paul Wegener, Hans Waßmann, Gertrud Eysoldt, Else Heims, Camilla Eibenschütz, um nur einige zu nennen. Reinhardts Ensemble war durch viele Jahre des Zusammenspiels unter seiner Regie wie ein Orchester aufeinander abgestimmt.
Der Spielzeit 1916/17 verlieh Max Reinhardts »Deutscher Zyklus« besonderen Glanz. Den Auftakt gab das Sturm- und Drang-Drama Die Soldaten von Jacob Michael Reinhold Lenz, das mit heißem Atem am Beschauer vorbeijagte. Aneinandergereiht einzelne Szenen, scheinbare Zerrissenheit, der die geschlossenste Einheit zugrunde lag. Vibrierende Vielheit des Lebens in einem Spiegel aufgefangen, zu einem Bild vereinigt. Zahnrädern gleich griffen die Szenen ineinander. Während des Dunkelwerdens, wenn sich die Bühne drehte, legte sich oft nur der Gleichklang der Stimmen wie eine Brücke zwischen sie und führte so zum nächsten Bild hinüber. Die Schauspieler: Hermann Thimig, Camilla Eibenschütz – und Werner Krauß in einer unvergesslichen Episode. Alles leidenschaftlich, innerlich, Sturm und Drang, und doch so sehr ein Schrei aus unserer Zeit. Einheitlich der Rahmen, der für alle Bilder geschaffen war: zwei Pfeiler, rechts und links, in deren Nischen Armleuchter standen. Von ihrem Strahlen ging eine Ruhe aus, die das Leben, das vorbeizog, nur noch hob. Max Reinhardt hatte mit dieser Inszenierung den Ausdruck für die Sprache einer Zeit gefunden, die in solchem Maße niemals vorher zum Leben erweckt, dem Heute so nahe gebracht worden war. Farben, Licht und Klang! Auferstehung eines Feuergeistes, dem die glättende Zeit nichts anhaben konnte. Kurz darauf folgte Das Leidende Weib von Friedrich Maximilian Klinger, in einer Bearbeitung von Sternheim, mit der Höflich in der Rolle der Gesandtin. Diese Aufführung musste neben der Vollblütigkeit des Stückes von Lenz etwas verblassen, und das Publikum nahm sie nicht gut auf. Dann aber kam Dantons Tod von Georg Büchner, diese Symphonie der Leidenschaften, von Reinhardt sein Leben hindurch immer wieder dirigiert. Das Bühnenbild stammte von Ernst Stern. Steil verloren sich die Reihen des Konvents in einer Art Nebel, aus dem Stimmen in scharfem Kontrapunkt zum Zuschauer drangen. Im Gegensatz dazu das Quartett der Kerkerszene – ein Adagio von unbeschreiblicher Harmonie. Der schnelle Wechsel der Szenen wurde durch Licht ermöglicht, das grell auf einzelne Gestalten und Dekorationen fiel, sie aus der Dunkelheit rings herum heraushob. Hinter allem Geschehen die Revolution, deren Grauen zwei Jahre später Europa zutiefst erschüttern sollte. Kabale und Liebe, Minna von Barnhelm und Judith von Friedrich Hebbel beschlossen den »Deutschen Zyklus«.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen.» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.