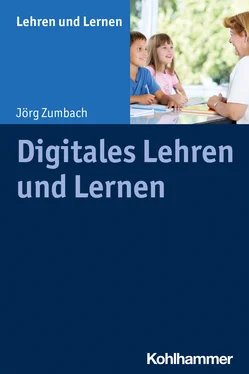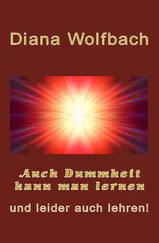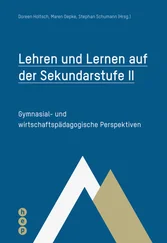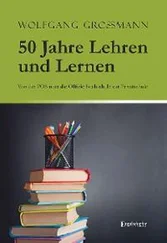Für verschiedene Inspirationen möchte ich mich bei den aktiven und ehemaligen Mitgliedern meiner Arbeitsgruppe an der Universität Salzburg bedanken, insbesondere bei Frau Dr. Stephanie Moser, Frau Dr. Ines Deibl und Frau Dr. Viola Geiger.
Erneut eine große Inspiration beim Verfassen dieses Buches waren Jonathan und Johanna. Es war nicht nur interessant zu sehen, wie sich Kinder Bildungstechnologien zu eigen machen, sondern zudem, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind. Aber gerade auch zu sehen, wie Schule nicht die Herausforderungen an einen digitalen Unterricht meistern kann, welche professionellen Kompetenzen Lehrkräften hier fehlen und wie schlecht Schulen in Bezug auf digitale Technologien ausgestattet sind, war und ist eine Inspiration. Während für jüngere Generationen der Umgang mit digitalen Medien nichts Neues ist, so scheint es für Lehrkräfte hier teilweise massiven Entwicklungsbedarf zu geben – in Schule wie auch Hochschule. Dieses Werk soll einen Beitrag dazu leisten, dass digitale Technologien den Alltag unserer Lernenden nachhaltig und positiv gestalten.
Salzburg im Frühjahr 2021
Jörg Zumbach
.∙.
1 Einleitung – Lernen mit digitalen Medien
Warum Lernen mit digitalen Medien? Auf diese Frage gibt es unzählige Antworten, die jeweils aus den Perspektiven resultieren, mit denen man sich diesem Bereich annähert. Zunächst kann dies eine kulturelle und gesellschaftliche Perspektive sein: In unserem Bildungswesen wurden und werden fortwährend verschiedene Medien integriert und für Lehr- und Lernzwecke genutzt. Prominente Beispiele sind etwa Bücher vor und nach Einführung des Buchdrucks, das Bildungsfernsehen, Tageslichtprojektoren oder digitale Technologien, seien es Laptops, Desktop-Computer oder Smartphones. Auch der gesellschaftliche Wandel und die damit einhergehende Verbreitung und Nutzung von Medien geben implizit Antwort auf die Frage, warum digitale Medien immer mehr Einzug in das Bildungswesen halten: Die Technologien stehen zur Verfügung und werden genutzt; die Verbreitung und Verfügbarkeit von Informationen über Datennetze erfolgt mit einer Geschwindigkeit, die vor etwa 20 Jahren noch nahezu undenkbar schien.
Es sind allerdings nicht nur Kultur und Gesellschaft, die eine wesentliche Rolle bei der Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien spielen. Aus psychologischer Sicht ist die Frage nach der Interaktion zwischen Mensch und Medium ein spannendes Feld, in welchem grundlegende Mechanismen der menschlichen Informationsverarbeitung, der Motivation und Emotion sowie der sozialen Ebene in den Vordergrund rücken.
Des Weiteren ist auch die Schnittstelle zwischen psychologischen Variablen und gesellschaftlicher Entwicklung ein spannender Bereich. Gerade wenn die Technologie durch portable Geräte immer und überall zur Verfügung steht, kann sich hieraus eine eigene Kultur entwickeln. Ein Beispiel ist etwa die Nutzung von Smartphones, welche aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Heute ersetzen sie viele traditionelle Medien wie etwa gedruckte Landkarten, bzw. verdrängen auch ältere digitale Geräte (z. B. Tablets anstelle von Laptops).
Die hier skizzierten Perspektiven verdeutlichen, welche Fragenkomplexe rund um das Thema »Lernen mit digitalen Medien« aufgebaut werden können. In diesem Buch stehen insbesondere Aspekte der Interaktion zwischen Menschen und Medien sowie deren Inhalten im Vordergrund. Diese Schnittstelle ist nicht mehr jung, so dass die Bezeichnung »Neue Medien« mittlerweile nicht mehr verwendet wird, sondern stattdessen vom Lernen mit digitalen Technologien gesprochen wird. Bereits mit der Verbreitung digitaler Technologien in Haushalten und Schulen gegen Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts beginnt eine annähernd 50-jährige Erfahrung im Umgang mit Computern und anderen digitalen Technologien.
Mittlerweile ist ein Leben in unserer Gesellschaft ohne digitale Technologien kaum mehr vorstellbar. Der Einbezug von Smartphones und anderen Technologien, die über Geräte vernetzten Menschen, all jene Produkte technischer Entwicklungen kommen auch bei formellen und informellen Lerngelegenheiten zum Einsatz. Gerade dabei dürfen die Inhalte und deren Darstellung in der digitalen Vermittlung nicht vernachlässigt werden. Insbesondere die Kombination von (fach-)didaktisch und mediendidaktisch aufbereiteten Inhalten ermöglicht Lernerfahrungen, die ohne die Digitalisierung kaum oder gar nicht denkbar wären. Sei es die interaktive Simulation wie beim Flugsimulator, die graphische Visualisierung von mathematischen Gleichungen oder der Weltraumspaziergang in der virtuellen Realität. All dies sind Entwicklungen und Angebote, die mittlerweile einfach zugänglich sind und die vor dem digitalen Zeitalter und neueren Entwicklungen im Hard- und Softwarebereich nicht möglich waren. Auch wird deutlich, dass technische, inhaltliche und gesellschaftliche Entwicklungen Hand in Hand gehen und Einfluss auf die Mediennutzung nehmen.
Gerade die rasante technologische Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten wie auch gegenwärtig trägt dazu bei, dass das Lernen mit digitalen Medien mittlerweile einen hohen Stellenwert einnimmt: Es geht einfach nicht mehr ohne.
Das übergeordnete Ziel dieses Buches ist es nun, unterschiedliche Chancen und Grenzen des Lernens mit digitalen Medien zu erörtern. Dabei soll die Brücke zwischen etablierten Theorien der pädagogischen und kognitiven Psychologie und praktischen Anwendungen bzw. didaktischen Ansätzen geschlagen werden. Konkret eröffnen sich damit die folgenden Leitfragen:
1. Was kennzeichnet das Lehren und Lernen mit Medien und was sind Gemeinsamkeiten mit bzw. Unterschiede zu analogen Medien?
2. Wie können digitale Lernmedien gestaltet werden?
3. Welche Lehr-Lernszenarien sind mit digitalen Medien möglich und welche Wirkung haben diese?
Ausgehend von diesen zentralen Fragen werden verschiedene Eigenschaften digitaler Medien analysiert und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf Basis empirischer Forschungsarbeiten betrachtet (vgl. hierzu auch Stegmann, Wecker, Mandl & Fischer, 2018; Wecker & Stegmann, 2019). Dabei stehen neben kognitiven Lerneffekten auch Auswirkungen auf motivationaler und emotional-affektiver Ebene bzw. deren Wechselwirkungen im Zentrum. Neben Studien zu unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten und -merkmalen digitaler Medien, werden teilweise auch Studien zu Vergleichen zwischen analogen und digitalen Lehr-Lernszenarien. Solche Vergleiche sind nicht immer unproblematisch, da bisweilen die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Vorgehensweisen nur unzureichend gegeben ist (vgl. hierzu u. a. das Media-Comparison-Paradigma; Bluemke & Zumbach, 2018). Aber auch diese Befunde können Aufschluss über günstige bzw. ungünstige Gestaltungsmerkmale von Lernumgebungen geben, werden jedoch sorgfältig diskutiert. Weniger problematisch sind theoretisch wie auch empirisch gesicherte Befunde zur Gestaltung digitaler Lehr- und Lernmedien, die zentral zur Beantwortung der o. a. Fragen sind.
Entsprechend orientiert sich auch der Aufbau dieses Buches zunächst an der Frage, was digitale Medien sind und welche Besonderheiten sie gegenüber analogen Lernszenarien aufweisen ( 
Kap. 1
). Mit zwei zentralen Eigenschaften digitaler Medien, der Interaktivität und Adaptivität, beschäftigt sich das zweite Kapitel. Zentral ist hier die Möglichkeit, dass Lernende mit digitalen Medien interagieren können und wie sich digitale Medien an die Bedürfnisse und Eigenschaften von Lernenden anpassen können ( 
Kap. 2
).
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie unterschiedliche Gestaltungsmerkmale (z. B. Text, Audio, Bilder, Animationen, Videos) in ihrer Kombination als sog. Multimediales Lernen verwendet werden können. Dabei spielt insbesondere die Art und Weise, wie wir uns die Funktionsweise der menschlichen Informationsverarbeitung vorstellen, eine zentrale Rolle ( 
Kap. 3
). Das vierte Kapitel ist dem Lernen mit Simulationen und dem Game-Based Learning gewidmet. Simulationen erlauben es u. a., bestimmtes Verhalten in einer sicheren Umgebung zu üben, oder auch selbst Dinge zu simulieren (z. B. in naturwissenschaftlichen Kontexten). Beim Game-Based Learning sind nicht nur der Lernprozess, sondern auch spielerisch-unterhaltende Aspekte zentral ( 
Kap. 4
).
Читать дальше