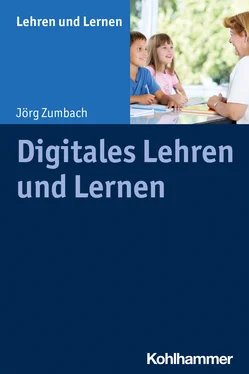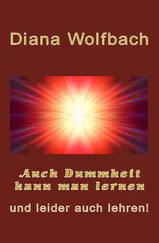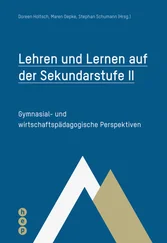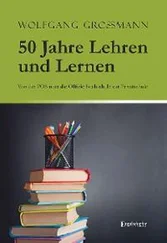Gegen Ende der 1980er Jahre wurde der pädagogische Konstruktivismus populär und bereicherte die Landschaft digitaler Lernangebote um neue didaktische Ansätze (vgl. Kollar & Fischer, 2019). Zentral für diese Ansätze ist die Annahme, dass jedes Individuum seine eigenen Erfahrungen und sein Vorwissen mit sich bringt und auch neue Informationen individuell und subjektiv verarbeitet. Entsprechend wurden hier Lernumgebungen konzipiert, welche ein aktives, exploratives und erfahrendes Lernen ermöglichen und Lernenden ein hohes Maß an Freiheit gewähren. Zu solchen Lernumgebungen gehören etwa hypermediale Lernumgebungen, in denen Lernende frei navigieren können (z. B. Zumbach, 2009). Auch Ansätze wie die Anchored Instruction (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1991, 1992), bei denen das Erkunden von Informationen anhand von navigierbaren Videos zentral war (hier anhand von Videodiscs, einem Vorgänger der DVD), wurden populär. Neben der zunehmenden Berücksichtigung individueller Einstellungen und Voraussetzungen nahm im Konstruktivismus auch die Bedeutung kooperativer und kollaborativer Wissenskonstruktionsprozesse zu (Kollar & Fischer, 2019). Im neuen Jahrtausend wurde dies erneut aufgegriffen und das neue Paradigma des Konnektivismus nach Siemens (2005; vgl. auch Siemens & Matheos, 2010) propagiert. Hierbei wird das »Wissen, wo?«, also das Wissen um die Ressourcenallokation in einer zunehmend vernetzten Welt, als zentrale Kompetenz im digitalen Zeitalter in den Vordergrund gestellt. Prinzipiell wird dabei zwar ein neues Lernparadigma postuliert, bei genauerer Betrachtung finden sich aber keine nennenswerten theoretischen Weiterentwicklungen (vgl. Bremer, 2013) gegenüber bisherigen konstruktivistischen Ansätzen, wie denen der Situated-Cognition-Bewegung und der Communities of Practice (vgl. Lave & Wenger, 1991; Resnick, 1991). Gerade aber die Einbindung von Individuen in soziale Netzwerke (also soziale Strukturen im eigentlichen Sinne) ist hier zentral, wie Lave und Wenger betonen (1991, S. 29; vgl. auch Zumbach & Astleitner, 2016):
»Learning viewed as situated activity has its central defining characteristic a process that we call legitimate peripheral participation. By this we mean to draw attention to the point that learners inevitably participate in communities of practitioners and that the mastery of knowledge and skills requires newcomers to move toward full participation in the sociocultural practices of a community.«
Mittlerweile zeigt sich, dass die Grenzen zwischen diesen Paradigmen bei der Gestaltung digitaler Lernangebote immer mehr verschwinden bzw. ein eklektischer, kognitivistisch orientierter Zugang dominiert. Rein konstruktivistische Ansätze wie etwa die Anchored Instruction (aber auch die Cognitive Flexibility Theory zum Einsatz von Hypermedien; vgl. Spiro & Jehng, 1990) sind mittlerweile praktisch bedeutungslos. Vielmehr stehen heutzutage eine gezielte Anpassung an die Eigenschaften von Lernenden und die zu erreichenden Lehrziele bzw. Kompetenzen sowie die daraus resultierende lernendengerechte Gestaltung digitaler Lernangebote im Vordergrund. Neben klassischen digitalen Trainingsprogrammen (z. B. Web-Based-Trainings) kommen auch explorative Lernumgebungen (z. B. Simulationen oder Spiele) zum Einsatz, wenngleich den Lernenden hier zumeist auch eine feste Struktur vorgegeben wird, um Überforderung zu vermeiden. Prinzipiell könnte man von einem Neo-Kognitivistischen Paradigma sprechen, in dessen Rahmen sowohl die Berücksichtigung individueller Eigenschaften der Lernenden und deren aktive Rolle beim Lernen als auch eine kontrollierend-anleitete didaktische Gestaltung von Lernangeboten zentrale Aspekte sind.
Zusammenfassung und Fazit
Lernen mit digitalen Medien und Technologien ist nicht neu, sondern hat sich in vielen Bildungsbereichen bereits fest etabliert. In einigen Bereichen besteht sicherlich noch weiterer Entwicklungsbedarf hinsichtlich der didaktisch-planvollen Nutzung von Technologien für Bildungszwecke. Dennoch kommen analoge Medien an ihre Grenzen, bzw. können digitale Medien Lernumgebungen anbieten, die mit analogen Medien nicht realisierbar sind (z. B. Simulationen). Die Entwicklung von Bildungstechnologien, also Technologien, die für Lehr- und Lernzwecke herangezogen werden, ist dabei nicht neu, sondern kann mittlerweile auf einige Dekaden der Entwicklung zurückblicken. Entsprechend haben sich auch eigene (medien-)didaktische Zugänge entwickelt, die teilweise eng mit allgemeinen Lehr-Lern-Paradigmen ihrer Zeit verbunden waren und sind. Manche Entwicklungen haben sich mittlerweile selbst überlebt. Das wiederum zeigt, dass hier, wie in vielen Bereichen, eine permanente Entwicklung vorliegt, bei denen sich bestimmte Ansätze und Bildungstechnologien etablieren und manche wiederum nicht.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.