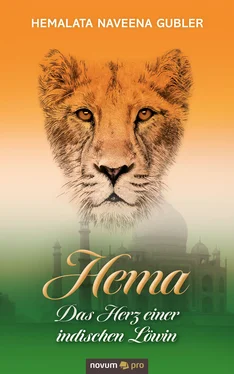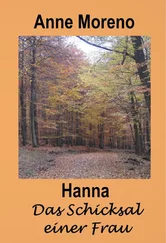In diesem Moment kam ein Mann in langem, weißem Kittel und setzte sich auf den Stuhl an meinem Bettrand. Er war sehr jung und ich überlegte mir, in welchem Alter er bereits sein Medizinstudium abgeschlossen haben musste, um jetzt schon den Titel des Oberarztes zu erlangen. Er kontrollierte nochmals mein Herz, es war nach wie vor alles in Ordnung. Er reichte mir eine kleine weiße Schmelztablette. Sie würde mir helfen, etwas zur Ruhe zu kommen, und wenn ich mich müde fühlen würde, dürfte ich mich dann zu Hause etwas hinlegen. Er legte mir noch ein durchsichtiges Tütchen auf den Tisch und fügte hinzu, dass dies Temesta sei und er dieses in einer solchen Situation immer mitgebe. Ich konnte erkennen, dass darin nochmals zwei weitere Tabletten enthalten waren. Ich würde heute also doch nicht sterben und durfte wieder nach Hause. Das war’s. Er ging und ich durfte noch einen Moment bleiben. Ich betrachtete die kleine weiße Tablette in meiner Hand. Ich war ein absoluter Gegner von Medikamenten. Ich nahm nur während der Schwangerschaft die notwendigen Medikamente wie Folsäure, Eisen und Vitamine für meine Kinder in meinem Bauch. Auch wenn ich Bauch- oder Kopfschmerzen hatte, griff ich nur im Alleräußersten zum Schmerzmittel. Außerdem nahm oder tat ich selten etwas, vorauf ich nicht vorbereitet war. Ich wollte stets wissen, weshalb etwas so war oder helfen sollte, was mögliche Konsequenzen oder in diesem Falle eventuelle Nebenwirkungen sein konnten.
Ich war auch absolut kritisch gegenüber Drogen. Nicht, dass ich nicht die eine oder andere Erfahrung damit gemacht hätte. So war es nicht mal in meinem kleinen, perfekten Leben. Ich hatte eine ziemlich rebellische Jugend. Wieso das so war, wurde mir erst zu einem viel späteren Zeitpunkt bewusst. In diesem Moment wollte ich einfach nur diese Ruhe und Gelassenheit genießen, welche ich so intensiv verspürte. Ja, das war genau das, was auch Drogen oder bestimmte Medikamente mit einem machen konnten: Gefühle und Stimmungen verändern. Der Vorhang ging wieder auf. Eine neue Krankenschwester kam herein und entfernte mir wortlos die Infusion und klebte mir ein weißes Pflaster auf die Einstichstelle der Nadel. Dann ging sie wieder. Ich richtete mich auf und erhob mich. Das Tütchen mit den beiden weiteren Tabletten steckte ich mir ein. Ich konnte sie ja noch immer wegwerfen. Falls ich sie jedoch brauchte, würde ich froh sein, sie bei mir zu haben. Vorsichtig löste ich die kleine Schmelztablette in meiner Hand aus ihrer Verpackung und das Temesta zerging auf meiner Zunge.
Mein Mann holte mich ab. Zu Hause war alles wieder gut. Ich war ruhig, gelassen und konnte mir nicht mehr vorstellen, was an diesem Tag alles passiert war und weshalb ich alles so intensiv erlebt hatte. Ich nahm an, dass es die Wirkung dieses Temestas war. Mein Kaffee, den ich heute Morgen zwar hingestellt hatte, aber nicht mehr trank, weil ich ihn aus lauter Stress vergessen hatte, schüttete ich nun weg. Irgendwann wurde ich sehr müde und schläfrig. Ich legte mich hin und schlief acht Stunden am Stück durch. Ich war wie im Koma. Wenn eines der Kinder gerufen hätte, hätte ich vermutlich nichts davon gehört. Ich war weg.
3
Die Wochen danach
Zwei Tage später musste ich nochmals ins Spital. Ich hatte so starke Bauchschmerzen und Angst, dass etwas mit meinem Magen oder Bauch nicht in Ordnung war. Mein Mann fuhr mich abends in die Notfallaufnahme, obwohl ich wusste, dass ich dort wieder lange warten würde, alleine in einem Wartezimmer, aktuell mit Schutzmaske, unter dieser ich wieder weniger Luft bekäme. Aber ich brauchte Gewissheit. Leon schlief bereits, als Dave mich mit Lilly ins Spital fuhr. Eigentlich wollte ich selber fahren, aber kaum war ich aus der Garage, ging nichts mehr. Ich hatte Angst, dass ich den Weg nicht schaffe, dass ich ohnmächtig werden könnte, dass ich zu erschöpft und müde war, um mich auf die Straße zu konzentrieren. Früher hätte ich nie weggehen können, wenn eines der Kinder geschlafen hatte, weil es ja jederzeit hätte aufwachen können und dann niemand da war. An diesem Tag musste es sein.
Im Spital wurden diverse Untersuchungen gemacht. Ein Ultraschall vom Bauch wurde durchgeführt, die Leber- und Nierenwerte geprüft, Bakterienstatus analysiert, Herztöne abgehört und noch vieles mehr. Alles war gut. Ich sei eine gesunde junge Frau, hieß es. Aber nach der Meinung der Ärzte litt ich an einer enormen Überbelastung und ich müsste dringend eine intensive Psychotherapie in Anspruch nehmen. Ich bräuchte wirklich Hilfe. Das war nicht sehr ermutigend und ich wusste nicht, was ich denken sollte.
Zu Hause versuchte ich, mich irgendwie abzulenken, doch in meinem Kopf rotierte es weiter. Ich war traurig und enttäuscht. Enttäuscht über mich selber.
Was, wenn es wirklich wahr war? Was, wenn ich wirklich plötzlich unter Panikattacken und Angstzuständen litt? War ich wirklich überfordert und überlastet mit meinem Leben? Wäre es besser gewesen, wenn ich nicht Mutter geworden wäre? Meine Kinder verdienten eine Mama, die alles schaffte und die Kraft hatte, und keine, die plötzlich Angst vor den normalsten Dingen dieser Welt hatte. Ich war nicht gut genug für sie. Sie hatten etwas Besseres verdient. Dieses Gefühl schmerzte so sehr in meiner Brust, dass ich zwei Stunden am Stück weinte und so dann irgendwann voller Erschöpfung einschlief.
Wie die nächsten drei Wochen verliefen, ist kaum zu beschreiben. Ich war nicht mehr ich selber. Ich lebte jeden Tag mit der Furcht, dass sich dieser 4. Juli wiederholen könnte. Ich hatte täglich schlimme Magenschmerzen und verspürte eine innere Unruhe und Nervosität in mir, die ich bis vor diesem Tag beim Kinderarzt nicht gekannt hatte.
Zwei Mal kam May vorbei und hatte für mich eingekauft und bei uns zu Hause Lasagne gekocht. May hatte ich vor über zehn Jahren in Australien kennengelernt. Ich pflegte gerne zu sagen, dass sie das beste Souvenir war, das ich aus Australien mit nach Hause genommen hatte. Einige Jahre waren wir sehr eng befreundet, hatten uns jede Woche mindesten einmal gesehen, machten die Zürcher Tanzclubs und Bars unsicher und verbrachten Nächte damit, die Staffeln von Sex and the City zu schauen und Wein zu trinken. Zusammen hatten wir in Australien wie auch hier, zurück in der Schweiz, die verrücktesten Geschichten erlebt. Ja, May kannte viele meiner Sünden und während ich an das eine oder andere Abenteuer dachte, prustete ich lautstark heraus. May war wunderschön und ich kannte niemanden sonst in meinem Umkreis, der so viele Tätowierungen hatte wie sie. Blumen, Ornamente, Früchte, da gab es Allerlei, was ihren Körper schmückte. Sie arbeitete auch einmal in einem Tattoogeschäft als Piercerin und konnte später sogar die Funktion als Filialleiterin dort übernehmen. Ich war stolz auf sie. Was unter anderem einer der Gründe war, wie ich selbst auf den Geschmack von Piercings und Tattoos kam. In den letzten Jahren hatten wir uns zwar ein bisschen auseinandergelebt, aber das war auch absolut verständlich. Schließlich lebten wir zwei völlig verschiedene Leben und mit Arbeit und Familie war es für mich nicht immer so einfach, alle Freundschaften noch gleich intensiv zu pflegen. May hatte seit ein paar Jahren auch wieder einen Freund und zog mit ihm in eine gemeinsame Wohnung. May und ihr Freund hatten aber noch Zeit zu Reisen, Ferien zu buchen, auswärts essen zu gehen und das ganze Wochenende auch einmal faul auf dem Sofa zu gammeln. Das war der Unterschied zu meinem Familienleben mit zwei Kindern.
Ich liebte Mays Lasagne und war ihr sehr dankbar dafür, dass sie Zeit hatte, mit Lilly herumzualbern und uns etwas Feines zu kochen. Leon war wie immer zufrieden in seiner Wippe und noch glücklicher, wenn er seiner Schwester zuschauen konnte. Sobald Lilly nämlich aus seinem Blickfeld verschwand, begann er zu weinen. Zuckersüß und eine Verbindung, die es so von Anfang an und mit dieser Verbundenheit wohl nur bei Geschwistern geben konnte. Wie es später einmal zwischen ihnen sein würde, wusste ja noch keiner.
Читать дальше