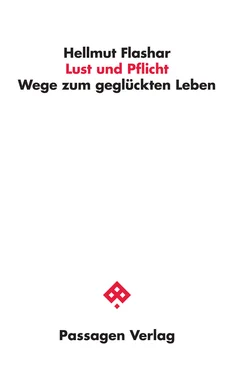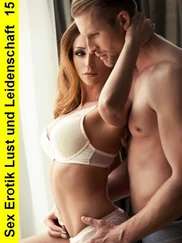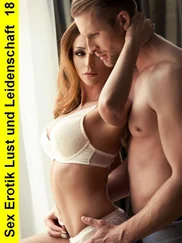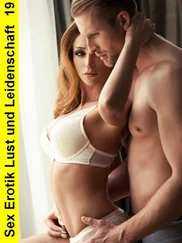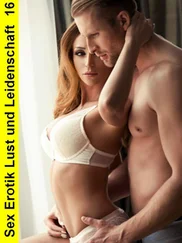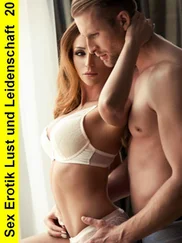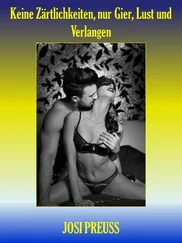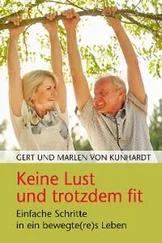Insgesamt sieht man, dass das Phänomen der Lust von allen Seiten her diskutiert und analysiert ist, noch bevor sie dann zum Schlüsselbegriff der Schule Epikurs im Rahmen der hellenistischen Philosophie geworden ist.
Die Pflichten, die dem Menschen als sozialem Wesen aufgegeben sind, werden praktiziert, aber nicht reflektiert. Wer seine religiösen Pflichten verletzt, konnte wegen Asebie angeklagt werden und galt als Atheist. Es gab auch einen vorsätzlichen Atheismus. So leugnete ein der Sophistik nahestehender Diagoras aus Melos (letztes Drittel des 5. Jh.s v. Chr.) die Existenz der Götter schlechthin und bestritt die mit den Eleusinischen Mysterien verbundenen Pflichten. Später gab es ganze Kataloge von Atheisten. Selbst das hat nicht zu einer generellen Bestimmung des Pflichtbegriffes geführt. Weder die ethischen, jeweils der konkreten Fragestellung eines Dialoges unterworfenen Diskurse Platons noch die Ethik des Aristoteles haben den Charakter einer deontologischen Ethik im strengen Sinne, die dem Menschen Pflichten auferlegte. Wohl durchzieht die Frage, wie man leben soll, die meisten Dialoge Platons. Aber es geht dabei nicht um strenge moralische Verpflichtungen, sondern darum, dass ein moralisch gutes Leben zum Glück, zur Eudaimonie , führt. Noch ausdrücklicher ist die Ethik des Aristoteles eine Glücksethik. Aristoteles schreibt dem Menschen nicht vor, die von ihm ausführlich beschriebenen Tugenden wie Gerechtigkeit, Tapferkeit, aber auch gesellschaftliche Gewandtheit sich als Pflichten anzueignen, sondern sieht in ihrer Verwirklichung die Möglichkeit, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen.
Entsprechend gibt es nur ganz wenige Zeugnisse über das Befolgen von Pflichten im konkreten Sinn. Gewiss gibt es Beschreibungen von berufsbezogenen Pflichten im konkreten Vollzug. Ein Beispiel dafür ist der hippokratische Eid , der dem angehenden Arzt berufsbezogene Pflichten in Auftreten und Handeln auferlegt. Aber es handelt sich dabei um eingegrenzte Pflichten für eine Personengruppe. Die Pflicht als solche kommt am ehesten in den Blick bei Demokrit: „Die Pflichten (wörtlich: „was man tun muss“) für das Gemeinwesen (für die Polis ) soll man unter allen für die größten halten“ (Frgm. 252). Und Theophrast, der Schüler und Nachfolger des Aristoteles, hat einen ganzen Pflichtenkanon aufgestellt (Frgm. 253 bei Fortenbaugh), in dem von der Sorge für Frau und Kind, für die alt gewordenen Eltern, von der Achtung der Gesetze die Rede ist. Wer das alles missachte, der habe die Gepflogenheiten der Gerechtigkeit verletzt. Es mag ein Zufall unserer fragmentarischen Überlieferung sein, dass es so wenige Zeugnisse für den Bereich der Pflicht gibt. Vielleicht aber ist es kein Zufall, dass das Zeugnis Demokrits weit entfernt vom Zentrum des politischen Lebens in Athen und der Pflichtenkanon Theophrasts aus einer Zeit nach dem Höhepunkt der Poliskultur stammen. Man sieht die Probleme besser aus einer Distanz.
Von großer Bedeutung ist es nun aber, dass im Hellenismus zwei wirkungsmächtige Philosophenschulen entstehen, deren eine – die Schule Epikurs – umfassend die differenziert analysierte Lust zum Ziel des Menschen erheben, während die andere – die Stoa – zu einer Ethik der Pflicht gelangt, wenn auch nicht sofort.
Lust und Pflicht in der hellenistischen
Philosophie
Die Ausgangslage
Die beiden neuen Philosophenschulen, der Kepos („Garten“) Epikurs und die Stoa, sind entstanden in der Zeit, die man – zumindest im deutschen Sprachbereich – Hellenismus nennt, mit einem Begriff, den der Historiker Johann Gustav Droysen (in seinem dreibändigen Werk Geschichte des Hellenismus 1836–1843 ) eingeführt hat. Im Einzelnen ist die Abgrenzung vor allem vom Beginn des hellenistischen Zeitalters umstritten und variiert auch in den einzelnen Gattungen der Literatur. Man verwendet diesen Begriff in der Regel für die Zeit nach dem Tod Alexanders (323 v. Chr.) bis circa 30 n. Chr. (Schlacht bei Actium). Es gab aber keine abrupte Epochenzäsur in Literatur und Philosophie, wohl aber in der Politik. Denn mit dem Tod Alexanders begannen die Diadochenkämpfe, das Großreich zerfiel in viele Kleinstaaten. Athen war zunächst unter einer makedonischen Besatzung; als Statthalter wurde der dem Peripatos nahestehende Demetrios von Phaleron eingesetzt. Sein Namensvetter Demetrios mit dem Beinamen Poliorketes („Städtebelagerer“) hat aber im Jahre 307 v. Chr. die madekonische Besatzung in Athen vertrieben und die Demokratie wiederhergestellt, bis auch er unter ständigen Kämpfen im Bemühen, ganz Griechenland einschließlich Makedoniens zu einen, im Jahre 283 v. Chr. starb.
Trotz der politisch unruhigen Zeiten blieb Athen das Zentrum der Philosophie. Das ist nicht selbstverständlich, sind doch mit Alexandria (332/1 gegründet) und Pergamon (an der Westküste Kleinasiens) zwei Städte entstanden, in denen Literatur gesammelt und gelesen wurde. Auch gab es noch kleine Philosophenschulen außerhalb Athens. Auf der Insel Kos und in Knidos waren Medizinerschulen etabliert und kleinere Philosophenschulen gab es auf Rhodos und in Kyrene (im heutigen Libyen). Athen hatte aber nach wie vor eine solche Strahlkraft, dass, wer im Bereiche der Philosophie wahrgenommen werden wollte, sich nach Athen begeben musste. Aber dort konnte er als einzelner nichts ausrichten, sondern nur im Verbund einer Schule wirken. Die Stadt hatte sich seit der Zeit des Sokrates gewandelt, war größer und anonymer geworden. Das musste schon Demokrit erfahren. Denn wenn die von Diogenes Laertius (3. Jh. n. Chr.) mitgeteilte Anekdote stimmt, Demokrit sei in Athen gewesen, aber niemand habe ihn beachtet (IX 36), so ist dies ein Hinweis darauf, dass er sich als einzelner nicht bewusst bemerkbar machen konnte. Im Grunde gilt schon für die platonische Akademie, dass man philosophische Kernfragen nur innerhalb einer Schule vertreten und diskutieren kann. Denn von den engeren Schülern Platons kam die überwiegende Mehrzahl von außen, die sich einzeln kein Gehör verschaffen konnten. Wir kennen namentlich 15 engere Schüler Platons. Unter ihnen waren nur zwei Athener, Speusipp, der Neffe Platons, und Xenokrates, die dann auch nacheinander die Nachfolger Platons in der Leitung der Akademie wurden. Aristoteles hatte es schwerer. Da er als Metöke (wörtlich: „Mitbewohner“) und Nicht-Athener keinen Grunderwerb tätigen konnte, war seine Schule juristisch nicht gefestigt, was erst durch seinen Nachfolger Theophrast gelang, der – obwohl auch er Nicht-Athener – eine Ausnahmegenehmigung erhielt. Mit Athenern allein wären die beiden Schulen nicht lebensfähig gewesen, kamen doch von alters her die philosophischen Impulse, vor allem auf dem Gebiet der Kosmologie und Ontologie, aus dem ionischkleinasiatischen Bereich. Erst mit Platon war (abgesehen von Sokrates) ein bedeutender Philosoph Athener.
So waren es zwei Philosophenschulen, die platonische Akademie und der Peripatos, die um das Jahr 300 v. Chr. das philosophische Leben in Athen beherrschten. 9
Für die Akademie bedeutete der Tod Platons (347 v. Chr.) einen tiefen Einschnitt, der auch sogleich als solcher empfunden wurde. Seine Nachfolger in der Leitung der Akademie, Speusipp und Xenokrates, haben vor allem die ontologischen Positionen Platons modifiziert und systematisiert. Während Speusipp mit der Auffassung vom Vorrang des Einzelnen vor dem Allgemeinen, verbunden mit einer Aufwertung der Wahrnehmung als einer philosophischen Position, die platonische Ontologie durchaus kritisch weiterentwickelt hat, gilt Xenokrates, noch unmittelbar Schüler Platons, 25 Jahre lang Scholarch der Akademie (335–314), als der konservative Sachwalter Platons. Er hat mit der systematischen Verfestigung des platonischen Werkes zugleich einen religiösen Zug der Ontologie eingefügt, indem er in den ontologisch primären Prinzipien göttliche Kräfte sah. Mit seinem Nachfolger Polemon (Scholarch 314–270) ist mit der fortan kanonischen Einteilung der Philosophie in Logik, Physik und Ethik der Schwerpunkt eindeutig auf den Bereich der Ethik gelegt, und zwar in der praktischen Anwendung und weniger im Einüben theoretischer Lehr- und Grundsätze. So taucht dann bei Polemon zuerst die Formel vom naturgemäßen Leben auf, die dann sowohl in der Stoa als auch in der Schule Epikurs aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Mit dieser zur Formel verdichteten Maxime war zunächst ein Leben gemäß der menschlichen Natur in der Differenzierung nach Leib, Seele und äußeren Gütern gemeint.
Читать дальше