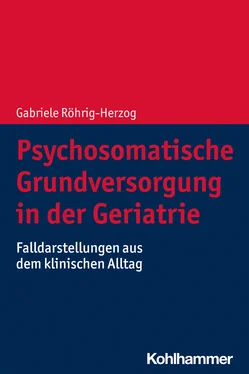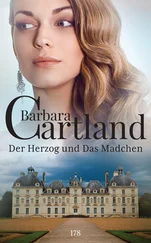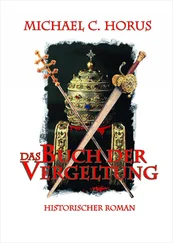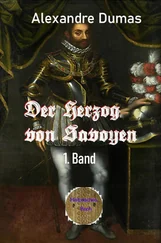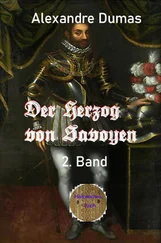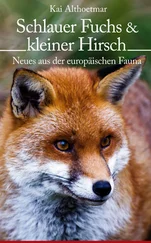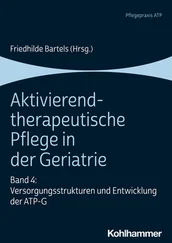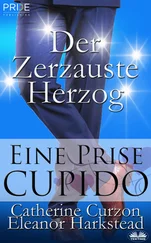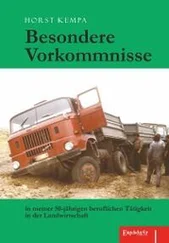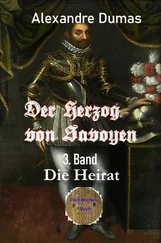Bei älteren Patienten, die einen (meist) jüngeren Arzt aufsuchen, wird das ärztliche Selbstverständnis jedoch gefährdet. Das liegt zum einen daran, dass der Patient altersbedingt über eine längere Lebenserfahrung verfügt und sich meist in einem Lebensabschnitt befindet, den der jüngere Arzt noch gar nicht erlebt hat und was dazu führen kann, dass Ängste vor dem eigenen Älterwerden hervorgerufen werden (Heuft et al. 2006; Maercker 2015). Zum anderen führt diese Situation oft zu einer Umkehr der klassischen Übertragungssituation: Der jüngere Arzt kann in dem älteren Patienten eine Eltern- oder Großelternfigur erkennen, mit allen assoziierten Ängsten, Wünschen, Befürchtungen und Konflikten.
So kann beispielsweise ein affektkontrollierter, kommunikativ eher zurückhaltender älterer Patient mit ausgeprägter Selbstdisziplin an den strengen und gefürchteten eigenen Großvater erinnern, der nie gelacht hat und vor dem man sich immer am liebsten verstecken wollte. Hier können durch die Rollenübertragung des Großvaters auf den älteren Patienten unbewusste kindliche Ängste hervorgerufen werden, die dazu verleiten, diesen Patienten möglichst (vor-)schnell wieder aus der Sprechstunde zu entlassen. Diese Suche nach Distanz zu dem Patienten könnte dann psychodynamisch dem kindlichen Wunsch entsprechen, davonzulaufen und sich zu verstecken.
Eine hochbetagte, gehbehinderte Patientin kann allerdings auch sehr positive Erinnerungen an die eigene verstorbene Großmutter hervorrufen, die einem sehr fehlt. Durch die Rollenübertragung der Großmutter auf die hochbetagte Patientin können sehr positive Gefühle wie Zuneigung und emotionale Nähe hervorgerufen werden, die es einem erleichtern, wegen der Patientin auch mal eine Überstunde oder einen Hausbesuch mehr zu machen, oder ihr mehr Zeit in der Sprechstunde einzuräumen.
Umgekehrt kann der ältere Patient in einem jüngeren Arzt auch sich selbst, seinen Sohn oder Enkel sehen und fühlt sich unwillkürlich in einer Sendungsfunktion, die auf der längeren Lebenserfahrung beruht. Diese Übertragung kann dazu führen, dass der betagte Patient durch den jüngeren Arzt an seinen »inkompetenten« Enkel erinnert wird, der seine Ausbildung zum Ärger des Großvaters abgebrochen hat. Durch diese Erinnerung kann es dazu kommen, dass der Patient auch die Kompetenz des jungen Arztes in Frage stellt.
Genauso ist es auch möglich, dass eine jüngere Ärztin die betagte Patientin an ihre früh verstorbene Tochter erinnert und sie dieser dadurch ganz besonders viel Zuneigung entgegenbringt.
Übertragungsphänomene sind nicht zwangsläufig ein Problem, sie sollten nur grundsätzlich berücksichtigt werden und spätestens dann auch angesprochen werden, wenn sich abzeichnet, dass sich aus ihnen eine konflikthafte und belastende Situation für eine oder sogar beide Seiten zu entwickeln droht.
2.1.6 Patienten mit Demenz
Obwohl die Effektivität psychotherapeutischer Maßnahmen einschließlich psychosomatischer Grundversorgung bei älteren Menschen heute wissenschaftlich gut belegt ist, gibt es darüber in Bezug auf Patienten mit Demenz nur sehr wenige Untersuchungen. Eine Literaturanalyse aus dem Jahr 2017 hat gezeigt, dass sich sowohl Depressivität als auch Lebensqualität von Demenzpatienten durch psychotherapeutische Maßnahmen günstig beeinflussen lassen (Linnemann und Fellgiebel 2017). Als besonders effektiv erwies sich dabei der Einsatz von Kurzzeittherapien in Gruppen.
Bei der von Naomi Feil entwickelten Methode der Validationstechnik handelt es sich um eine auf Wertschätzung, Empathie und Akzeptanz beruhenden Kommunikationsform mit demenzkranken Menschen (Feil und Klerk-Rubin 2017). Sie geht mit ihren Wurzeln auf die drei Säulen der personenzentrierten Gesprächstherapie von Carl Rogers zurück (Echtheit (= Kongruenz), Wertschätzung und Empathie), mit denen der Therapeut dem Patienten begegnen sollte (Rogers 2013). In ihren Lehrvideos vermittelt Naomi Feil diese Methode in einer sehr eindrucksvollen und lebensnahen Form (Feil 2018). Es geht darum, den Menschen in seiner Welt zu akzeptieren und seine Gefühle zu respektieren, völlig unabhängig davon, ob sie einem in der gegenwärtigen Situation sinnvoll erscheinen. Die meisten Menschen wenden die Validationstechnik im Alltag schon ganz unbewusst an, zum Beispiel im Umgang mit Kindern: Wenn Ihre mit Krönchen auf dem Kopf und in schillernd-pinkfarbenem Kleid kostümierte kleine Tochter Sie fragt: »Schau mal, wer bin ich?«, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit sagen: »Oh, du bist eine Prinzessin.« und Ihre Tochter ist glücklich, dass Sie sie »erkannt« haben. Sie ist in ihrer Fantasiewelt in die Rolle einer Prinzessin geschlüpft und denkt, fühlt und agiert auch so. Hätten Sie die Kostümierung ignoriert und realitätstreu mit »Du bist meine Tochter.« geantwortet, wäre sie sicher irritiert gewesen. Sie haben aber »validiert« und sie in ihrer Rolle wertgeschätzt und so akzeptiert, wie sie ist. Dadurch, dass Sie sie nicht auslachen, sondern ihr empathisch antworten, reagieren Sie kongruent, also den Empfindungen des Gegenübers entsprechend.
Im Umgang mit demenzkranken Menschen ist das ebenfalls möglich: Treffen Sie auf einen demenzkranken älteren Herrn, der Papiertaschentücher sortiert, und fragen ihn, was er da macht, wird er Ihnen vielleicht antworten, dass er wichtige Akten sortiert. Gehen Sie dann validierend auf ihn ein und fragen Sie ihn, ob Sie ihm beim Sortieren helfen können, dann fühlt er sich verstanden und akzeptiert. Sie haben eine Vertrauensbasis hergestellt. Versuchen Sie hingegen ihn darüber aufzuklären, dass es sich um Papiertaschentücher und keine Akten handelt, wird er sich mit großer Wahrscheinlichkeit stark verunsichert fühlen, da er aufgrund seiner Demenz diese Informationen (Akten – Papiertaschentücher) nicht mehr in Einklang bringen kann. Diese Verunsicherung kann im ungünstigsten Fall große Ängste hervorrufen. Validierung kann daher auch gut dazu beitragen, Ängste zu reduzieren, indem ein Gefühl von Verständnis und Sicherheit vermittelt wird.
Eine demenzkranke und kriegstraumatisierte Dame, die bei einem starken Gewitter glaubt, bombardiert zu werden, kann man damit versuchen zu beruhigen, dass man mit ihr zusammen in den Keller geht, so wie sie es während der Kriegszeit getan hat. Während einem das Validieren im Umgang mit Kindern oft leichter fällt, gibt es einige Menschen, die befürchten, durch Validation einen älteren Menschen respektlos zu behandeln, da man diese ältere, lebenserfahrenere Person ja »belüge«. Eine Lüge setzt jedoch die Absicht voraus, einem anderen Menschen bewusst eine Fehlinformation zu geben. Bei der Validation hingegen handelt man nur entsprechend dem vorgegebenen Verhalten des Patienten, indem man darauf eingeht. Man sagt dem Patienten, der sich für Napoleon hält, nicht, dass er Napoleon ist, sondern dass er ja eine verantwortungsvolle Aufgabe habe. Damit fühlt er sich in seiner angenommenen Rolle bestätigt und verstanden (Feil und Klerk-Rubin 2017). Obwohl die Validationstechnik bisher kaum wissenschaftlich belegt ist und daher noch keinen Eingang in Leitlinien und Handlungsempfehlungen gefunden hat (Neal und Barton Wright 2003), so hat sie im Bereich der Pflege inzwischen einen festen Stellenwert (Bibliomed Pflege 2016; Rabes 2016) und auch viele Ärzte wenden sie oft unbewusst aber erfolgreich an.
2.1.7 Patienten mit Migrationshintergrund
Im Jahr 2019 lebten in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 21,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, von denen etwas mehr als 2 Millionen mindestens 65 Jahre alt waren. Die Gruppe der Türkeistämmigen machte dabei mit 2,8 Millionen die größte Gruppe aus, gefolgt von Polenstämmigen (2,2 Millionen) und Menschen der russischen Föderation (1,3 Millionen) (Statistisches Bundesamt DESTATIS 2020). In den nächsten Jahren ist mit einer deutlichen Zunahme hochaltriger und pflegebedürftiger Menschen mit Migrationshintergrund zu rechnen, wobei das Durchschnittsalter dieser Gruppe mit 62,1 Jahren unter dem der Gesamtbevölkerung mit 72,2 Jahren liegt (Marquardt et al. 2016; Kohls 2012).
Читать дальше