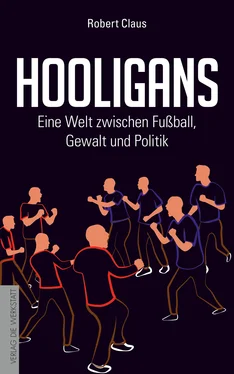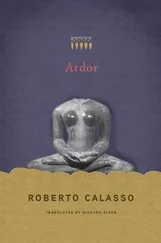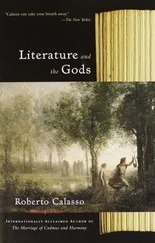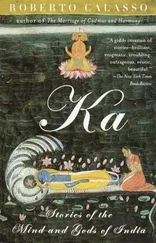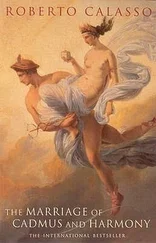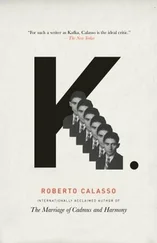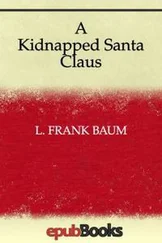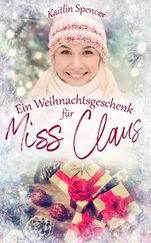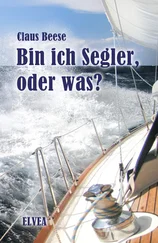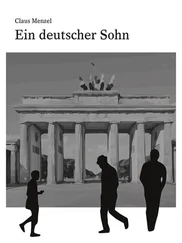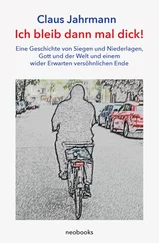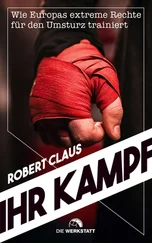Zu guter Letzt hilft auch der Begriff „Szene“ weiter, um Hooligans zu analysieren. Die Sozialwissenschaftler Ronald Hitzler und Arne Niederbacher definieren eine Szene in ihrem Buch „Leben in Szenen“ (2010) als thematisch fokussierte Netzwerke, in denen sich Menschen durch Kommunikation und Interaktion mit anderen verorten. Sie verfügen über eigene Treffpunkte und Codes sowie Eliten, die für die Organisation der Szene sorgen. Überträgt man diese Gedanken auf Hooligans, muss letztlich in Anbetracht der geschilderten und über Jahre entwickelten Ausdifferenzierung in mindestens drei Ebenen unterschieden werden: Erstens gibt es die kleine, aber zentrale Gruppe aktiver Hooligans, die an den Kämpfen teilnehmen. Sie stehen im Zentrum des Geschehens. Zweitens gibt es viele Angehörige der Szene, die über Gewalterfahrung verfügen und die Netzwerke kennen – z. B. aus der Erfahrung ihrer früheren Tage oder weil sie sich im Umfeld der prügelnden Gruppe bewegen, selber aber nicht zu abgemachten Kämpfen fahren. Und drittens gibt es Sympathisanten, die Hooliganmusik hören, sich an dem Kleidungsstil orientieren und auf Facebook die entsprechenden Videos teilen. Ihr gemeinsames Thema ist die Gewalt – zumeist im Zusammenhang mit Fußball –, worüber sie in Kneipen, Internetforen und bei Kampfsportturnieren sprechen.
Nicht zuletzt gibt es aktive Hooligangruppen an fast allen Orten des höherklassigen Fußballs in Deutschland. Auch wenn die Mitglieder nicht homogen sind und sich unter ihnen Menschen finden, die nicht rechts denken, sind viele doch rechtsoffen und sympathisieren mit rechtsextremen Einstellungen. Die meisten Gruppen haben zwischen 20 und 70 Mitglieder (wobei nicht alle konstant an den Kämpfen teilnehmen), von denen wiederum zwischen drei und sechs zur Führung gehören. So kann die Größe der gesamten Szene letztlich auf einige hundert aktiv kämpfende Hooligans, dazu Angehörige der gesamten Szene im hohen vierstelligen und Sympathisanten bzw. Interessierte im niederen fünfstelligen Bereich geschätzt werden, wie die Zahlen der stark frequentierten Facebookseiten aufzeigen. Dabei verfügen in der letztgenannten Gruppe bei weitem nicht alle über eigene Erfahrung aus Kämpfen. Auch Hooliganismus hat somit eine eigene Fankultur entwickelt. Wohlgemerkt sind die Zahlen Schätzungen anhand von Eindrücken, Demonstrationen und Facebookseiten. Eine vollständig abgesicherte Zahl durch Mitgliederlisten kann es kaum geben.
Eine umstrittene Datei: „Gewalttäter Sport“
Eine weitere Quelle für das Thema Gewalt im Fußball – und somit auch bedingt über Hooliganismus – ist der Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS). Sie wurde 1992 beim Land Nordrhein-Westfalen eingerichtet und übernimmt bundesweite Aufgaben. Sie arbeitet auch dem BKA zu, welches die Datei „Gewalttäter Sport“ leitet. In dieser waren im Juni 2017 10.646 Personen aus den ersten drei landesweiten Ligen vermerkt. Zur Eintragung führen u. a. schwere Eingriffe in den Verkehr, Haus- und Landfriedensbruch, Raub- und Diebstahldelikte sowie Volksverhetzung im Rahmen von Sportveranstaltungen, also auch außerhalb eines Stadions am Spieltag. Gleichwohl kritisieren Fanorganisationen die Datei. Das Bündnis ProFans mahnte wiederholt an, dass auch Personen in die Datei geraten, die schlichtweg zur falschen Zeit am falschen Ort und nicht an strafrechtlich relevanten Handlungen beteiligt waren. Eventuelle Folgen, wie ein Stadionverbot, hätten dennoch Bestand, bis die teilweise über Jahre dauernden Ermittlungen abgeschlossen seien.
Im Jahresbericht für die Saison 2014/15 wird der Anteil „rechtsmotivierter“ Fans in der Datei „Gewalttäter Sport“ mit 3,5 % bzw. 410 Personen angegeben. Die Anzahl der Strafverfahren gemäß § 86a StGB – Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – lag im Vorjahr bei 31. Die verhältnismäßig geringen Zahlen lassen sich mit einer Reihe an Anmerkungen erklären. Zuallererst ist es gar nicht das Ziel des Jahresberichts, eine Übersicht über die Größe der deutschen Hooliganszene zu geben, sondern allein die registrierten Straftaten und Ermittlungen im Umfeld von Fußballspielen zu vermerken. Im Bericht selber wird darauf hingewiesen, dass jenseits der Spielorte „Drittorte“ für gewalttätige Auseinandersetzungen aufgesucht werden. Die Dunkelziffer ist dementsprechend hoch. Zweitens konzentrieren sich weite Teile des Berichts auf die erste, zweite und streckenweise dritte Liga. Tiefer spielende Vereine mit größerem Fanaufkommen und Hooligangruppen – wie der BFC Dynamo, Lok Leipzig und Waldhof Mannheim – fallen so aus der Statistik. Drittens entscheiden die einzelnen Länderpolizeien darüber, ob ein Vorfall als rechtsextrem einzuordnen ist. Die Erfahrung aus anderen Bereichen zeigt, dass es entsprechend unterschiedlich gehandhabt wird.
Auch Till Claus beschäftigt sich beruflich mit der Datei „Gewalttäter Sport“. Er ist beim LKA 645 in Berlin tätig, „Ermittlungsgruppe Hooligan“ (EGH). Seit 2007 arbeitet er im Kommissariat, seit 2015 als stellvertretender Kommissariatsleiter. Zum Interview auf dem großen Gelände der Polizeidirektion im Berliner Stadtteil Lankwitz gehen wir einen langen, hell beleuchteten Flur entlang, über einen großen Hof in ein zweites Gebäude. Im Trakt der Ermittlungsgruppe angekommen, empfangen uns Wände, die mit Fußballutensilien gekleidet sind: Schals vom BFC Dynamo, von Legia Warschau und ein Bilderrahmen mit einem T-Shirt, auf dem „Hoolizei“ steht. Daneben ein Badge „Good Night – Cop Side“ sowie ein Artikel aus der „BZ“ über die Hooligans vom BFC. Es sind Relikte aus früheren Einsätzen. Claus war lange Jahre szenekundiger Beamter. Wie für Wissenschaftler und Pädagogen bleiben auch für ihn Fragen von Nähe und Distanz zentral. Jede Berufsgruppe altert mit ihrer Klientel.
„Wir sind keine Ermittlungsgruppe mehr im klassischen Sinne, aber der Begriff hat sich Anfang der 2000er Jahre etabliert und wurde seither beibehalten“, sagt Claus über seine Tätigkeit. Er leitet die größte Dienststelle der „Szenekundigen Beamten“ (SKB) in der Bundesrepublik, 20 Mitarbeiter. Dies hat zwei Gründe: Zum einen sind seine Beamten keine reinen SKBs, denn sie führen auch Ermittlungsverfahren. Zum anderen spielen in Berlin drei höherklassige Vereine. Deren „Problemfans“, wie Claus sie nennt, machen auch den Großteil der in den Dateien aufgelisteten Personen aus. „Ein Problemfan ist eine Person, die im Umfeld eines Berliner Sportereignisses entweder als Straftäter oder als Störer auffällig wird und dafür auch zukünftig in Betracht kommt“, führt Claus aus. Die Polizei pflegt indessen zwei Dateien. Da wäre erstens die erwähnte deutschlandweite Polizei-Verbunddatei „Gewalttäter Sport“. „Sie soll jeden Beamten bundesweit in die Lage versetzen, eine akute Lageeinschätzung erstellen zu können. Denn ein bayerischer Polizeibeamter kann aufgrund des föderalen Systems nicht auf das Berliner Dateisystem zugreifen.“ Sie umfasse „Stummeldaten“ und Angaben über Vorfälle mit den Personen, keine Daten über Lebensläufe oder konkrete Vorwürfe. Doch die Landespolizeien handhabten die Auswahl und Übermittlung der Daten durchaus unterschiedlich, gibt Claus zu.
Zweitens gibt es die lokale Datei „Sportgewalt Berlin“. Sie umfasst derzeit knapp 1.400 Datensätze. Über 400 davon beziehen sich jeweils auf Fans von Hertha BSC und Union Berlin, 364 auf Anhänger des BFC Dynamo. Daneben finden sich vereinzelte Daten über Fans anderer Fußball-Bun-desligisten, von Eishockeyklubs wie den Berliner Eisbären oder dem ES Jungfüchse Weißwasser sowie dem polnischen Verein Pogon Stettin. In der Datei werden Personaldaten wie Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, Arbeitsstelle, vorgangsbezogene Daten über Strafanzeigen, Verfahrensausgänge sowie polizeiliche Maßnahmen gespeichert. Es bedarf keines Strafverfahrens, um in die Datei aufgenommen zu werden. Vielmehr werden auch „Störer“ verzeichnet, gegen die beispielsweise Platzverweise erfolgt sind. In jedem einzelnen Fall sei jedoch eine Begründung für die Speicherung notwendig, erläutert Claus.
Читать дальше