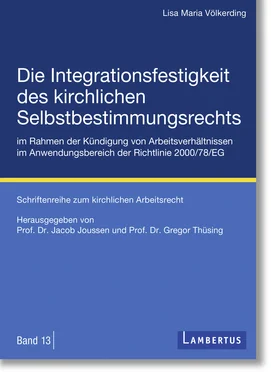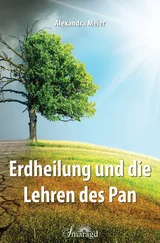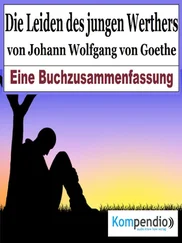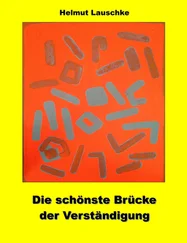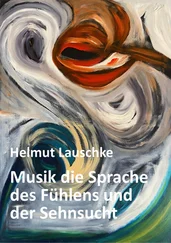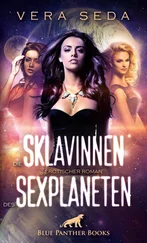4. Zusammenfassung und Stellungnahme
§ 1 KSchG und § 626 BGB stellen besonders relevante, „für alle geltende Gesetze“ i.S.d. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV dar. 378Die „weltlichen“ Arbeitnehmerschutzgesetze finden kraft Rechtswahl auf die kirchlichen Arbeitsverhältnisse Anwendung 379und eröffnen eine Rechtskontrolle durch die staatliche Arbeitsgerichtsbarkeit. Diese der Justizgewährungspflicht folgende Kontrolle wird wiederum durch die verfassungsrechtlich garantierten Besonderheiten des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften begrenzt. 380Das BVerfG hat in den Leitentscheidungen Stern und Chefarzt bestimmt, dass die Untersuchung von kirchlichen Kündigungsentscheidungen in zwei Stufen zu erfolgen habe:
Auf erster Stufe sei der kirchliche Vortrag lediglich auf seine Plausibilität hin zu überprüfen. 381Den Arbeitsgerichten sei insbesondere eine eigenständige Überprüfung des Tätigkeitsbezugs der infrage stehenden Loyalitätsanforderung verwehrt. 382Diese Bindungswirkung des kirchlichen Selbstverständnisses unterliege allein der allgemeinen Grenze der grundlegenden verfassungsrechtlichen Gewährleistungen. 383
Auf zweiter Stufe folge eine Gesamtabwägung, bei der „im Lichte des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts“ die grundgesetzlich garantierten Rechte der Kirche und die Grundrechtspositionen der betroffenen Arbeitnehmer in einen Ausgleich zu bringen seien. 384Zwar stellte das BVerfG einerseits klar, dass die (Grund-)Rechte der Arbeitnehmer ausnahmslos bei jeder Bewertung eines Loyalitätsverstoßes zu berücksichtigen seien, andererseits komme dem schrankenlos gewährleisteten kollektiven Religionsfreiheit ein „besonderes Gewicht“ zu. 385Damit bestätigt das Gericht, dass eine Grundrechtsabwägung nach besonderer, „eigener Formel“ 386durchgeführt werden muss, die der einzigartigen Stellung der Kirche im staatlichen Gefüge als eine vor dem Staat gewesene Ordnung mit originären Rechten entspricht. 387
Dem BVerfG ist zuzustimmen. Das Gericht füllt die Schrankenregelung des Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV im Sinne der hier befürworteten Wechselwirkungslehre aus. Bei der Berücksichtigung der durch die für alle geltenden Gesetze geschützten Arbeitnehmerrechte muss dem Selbstbestimmungsrecht hinreichend Rechnung getragen werden.
Durch die vom BVerfG vorgegebene „besondere“ Gewichtung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts werden die Arbeitnehmerrechte nicht unverhältnismäßig beschränkt. 388Das Grundgesetz selbst gibt durch die schrankenlose Sicherung der korporativen Religionsfreiheit in Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG die besondere Gewichtung des Selbstbestimmungsrechts der Kirche im Rahmen der Grundrechtsabwägung vor. 389Eine solche Einordnung hat das BVerfG auch bereits bei anderen schrankenlos gewährleisteten Grundrechtspositionen vorgenommen. 390Besondere Härtefälle werden bereits durch das „ultima-ratio“ -Prinzip der GrOkathK sowie der EKD-RL erfasst, zumal das BVerfG klargestellt hat, dass das Abwägungsergebnis durchaus auch zugunsten der Arbeitnehmerrechte ausschlagen kann. 391Etwaige unverhältnismäßige Ergebnisse werden ferner durch die Berücksichtigung des Umstands, inwieweit sich der Arbeitnehmer den besonderen Freiheiten der Kirche arbeitsvertraglich unterworfen hat, vermieden. 392
Der bewusste Verzicht auf eigene Schutzrechte schwächt den Arbeitnehmer im Kündigungsschutzprozess, ohne dass dies als unbillig zu bezeichnen wäre. Denn wer die Vorteile eines kirchlichen Beschäftigungsverhältnisses in Anspruch nehmen will, kann diese nicht ohne die Bereitschaft einfordern, sich innerhalb der durch das BVerfG aufgezeigten Grenzen den Ansprüchen des kirchlichen Dienstgebers an seine eigene Lebensführung zu fügen. Dies gilt umso mehr, als diese Anforderungen den Arbeitnehmer nicht zu unmoralischem oder gar ungesetzlichem Verhalten veranlassen. Wenn der Arbeitnehmer seine Lebensführung gleichwohl nach nichtkatholischen Vorstellungen zu gestalten wünscht, bleibt ihm dies möglich. Es dürfte der katholischen Kirche allerdings nicht abzuverlangen sein, einen solchen Arbeitnehmer an der Verwirklichung ihres Sendungsauftrag zu beteiligen. Die katholischen Kirche verfolgt die selbstgewählte Aufgabe, die Gesellschaft nach biblischen Grundsätzen zu verändern, damit die Menschen nach ihrem Tod in das Reich Gottes gelangen können. 393Ihr Auftrag wäre daher gefährdet, wenn sie verpflichtet wäre, sich völlig den Bestimmungen des säkularen Arbeitsrecht zu unterwerfen. 394Der Sendungsauftrag der Kirche ist naturgemäß mit Belastungsproben für die nach weltlichen Gepflogenheiten operierende Gesellschaft verbunden. Diese spiegelt sich in der Überforderung des Einzelnen wieder, wenn er Christi Lehre zu folgen „willig“ ist, sich sein „Fleisch“ indes als „schwach“ erweist. 395Schon Jesus Christus forderte nach der Bibelüberlieferung diejenigen, die seine Jüngern werden wollten, auf, nach seinen Vorgaben zu leben, was den einen oder anderen davon abhielt, sich seiner Gemeinschaft anzuschließen. 396
22 Siehe zum Bedeutungsunterschied der Begriffe der „Selbstbestimmung“ und der „Autonomie“ in diesem Sinne Hesse, in: Listl/Pirson (Hg.), HdbStKiR Bd. 1, 2. Aufl. 1994, § 17 S. 521 ff., S. 521.
23 Siehe hierzu auch die Ausführungen unter § 5 B. III. 2. a. aa. Siehe zur Geschichte des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts Stern, in: ders. (Hg.), Staatsrecht Bd. IV/2, § 118 S. 897 ff.; de Wall/Muckel, Kirchenrecht, 5. Aufl., § 2 – § 7; vgl. ferner vertiefend Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 3. Aufl.
24 Ebers, Staat und Kirche, Vorwort S. X.
25 Korioth, in: Maunz/Dürig (Begr.), GG Kommentar (Stand: 92. Lfg. 2020), GG Art. 140 Rn. 1 m.w.N. Gebräuchlich sind aber auch Begriffe wie „Übernahme“, siehe v. Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl., S. 40 sowie „Rezeption“, siehe W. Weber, VVDStRL 11 (1954), 153, 157.
26 BVerfGE 19, 206, 219; BVerfGE 19, 226, 236; BVerfGE 111, 10, 50; BVerfGE 137, 273, 303 Rn. 83 (Chefarzt). Siehe für die Literatur bspw. Korioth, in: Maunz/Dürig (Begr.), GG Kommentar (Stand: 92. Lfg. 2020), GG Art. 140 Rn. 1; Stern, in: ders. (Hg.), Staatsrecht Bd. IV/2, § 119 S. 1175; Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 8. Aufl., § 1 Rn. 6.
27 Hesse, in: Listl/Pirson (Hg.), HdbStKiR Bd. 1, 2. Aufl. 1994, § 17 S. 521 ff., S. 521.
28 Es besteht Streit darüber, ob in diesem Zusammenhang der Begriff des „Staatskirchenrechts“ oder des „Religionsverfassungsrechts“ anzuwenden ist. Der Begriff des „Staatskirchenrechts“ ist insbesondere historisch begründet, jedoch dogmatisch angreifbar, da Art. 137 WRV nicht lediglich die Kirche als Institution benennt, sondern die „Religionsgesellschaft“ und damit alle möglichen Religionen umfasst, siehe auch mit vertiefter Diskussion Korioth, in: Maunz/Dürig (Begr.), GG Kommentar (Stand: 92. Lfg. 2020), GG Art. 140 Rn. 2 f.; Unruh, Religionsverfassungsrecht, 4. Aufl., § 1 Rn. 4 ff.; siehe auch Häberle/Kotzur, Europäische Verfassungslehre, S. 858 Rn. 1359. Bei der Betrachtung des kirchlichen Arbeitsrechts kann zwar der Begriff des „Staatskirchenrechts“ weiterverwendet werden, siehe Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 8. Aufl., § 1 Rn. 3. Da aber Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 1 WRV für Deutschland die „Staatskirche“ ausschließt, wird in dieser Arbeit, um Missverständnisse auszuschließen, der Begriff des „Religionsverfassungsrechts“ verwendet.
29 Vgl. zu den Hintergründen vertiefend Schlink/Poscher, Der Verfassungskompromiß zum Religionsunterricht, S. 41 ff.
30 So auch Hesse, in: Listl/Pirson (Hg.), HdbStKiR Bd. 1, 2. Aufl. 1994, § 17 S. 521 ff., S. 534; Thiel, in: Sachs (Hg.), GG Kommentar, 8. Aufl. 2018, GG Art. 7 Rn. 4.
Читать дальше