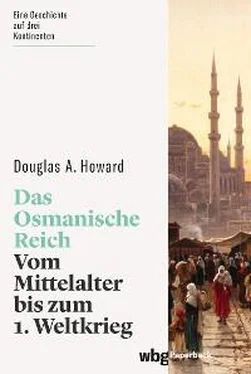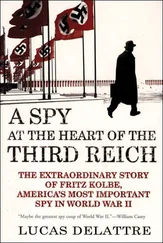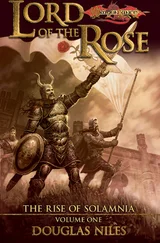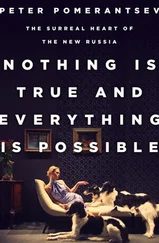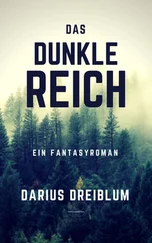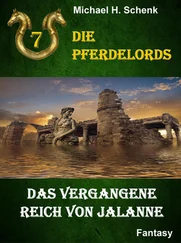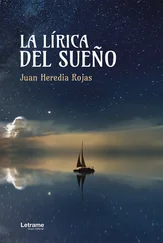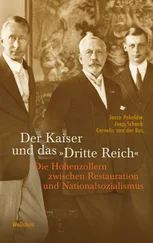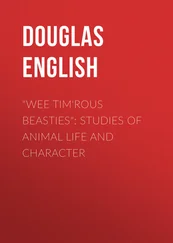1 ...8 9 10 12 13 14 ...27
Gregorios Palamas und der glaubensübergreifende Dialog
Palamas’ interreligöse Begegnung nahm ihren Anfang, als sein Schiff auf dem Weg nach Konstantinopel, wo er bei der Beilegung des byzantinischen Bürgerkriegs als Vermittler fungieren sollte, kurz nach dem Marmara-Erdbeben vom März 1354 von osmanischen Soldaten geentert wurde. Man brachte seine kleine Mönchsgruppe vor Sultan Orhan in Bithynien. Palamas hat seine Erlebnisse bei den Türken im Brief an die Thessalonicher geschildert. 74Der Titel erinnert an den gleichnamigen Paulusbrief im Neuen Testament. Palamas’ erstes interreligiöses Gespräch begann, als Ismail, der Enkel Sultan Orhans, den Erzbischof fragte, wieso er kein Fleisch esse. Während sie sich unterhielten, wurden sie von einem Boten unterbrochen, der Ismail mitteilte, Orhan habe die wöchentliche Almosenverteilung an die Armen beendet. Ismail nutzte diese Unterbrechung als Überleitung und fragte Palamas, ob auch die Christen Wohltätigkeit praktizierten. Von den Almosen verlagerte sich das Gespräch auf den Prophetenstatus Mohammeds, die Jungfrauengeburt Jesu und die Heilige Dreifaltigkeit. Die Unterhaltung endete, als ein Gewitterregen niederging und alle im Trockenen Schutz suchten.
Etwas später organisierte Orhan persönlich eine theologische Debatte, die der Arzt des Sultans, ein griechischer Christ, protokollierte. Palamas trat gegen eine Gruppe muslimischer Gelehrter an, wahrscheinlich frühere Schreiber der Ilchaniden, die jetzt in Orhans Diensten standen. 75Lang und breit erklärte Palamas die Dreifaltigkeit, und die folgende Debatte kreiste um die Göttlichkeit Christi und die Weigerung der Christen, Mohammed als Gottes Propheten anzuerkennen. Auch die Beschneidung, die Ikonen und andere Themen kamen zur Sprache. Gegen Ende der Debatte verlor einer der Muslime die Beherrschung und gab Palamas eins auf die Nase! Hastig schleppte man ihn zur Bestrafung vor den Sultan.
Nachdem er einem muslimischen Begräbnis beigewohnt hatte, kam Palamas schließlich mit einem Imam ins Gespräch. Wie zuvor fing Palamas mit der Dreifaltigkeit an, und der Imam reagierte mit einer Frage: Nachdem die Muslime alle Propheten der Christen anerkennen, warum akzeptierten die Christen nicht Mohammed? Palamas’ Argumentation – dass das Alte und Neue Testament die Ankunft Mohammeds nicht voraussagten, sondern stattdessen vor falschen Propheten warnten, und dass Mohammed durch „Krieg und das Schwert, Plünderung, Versklavung und Hinrichtungen“ aufgestiegen sei – brachte ihn bei seinen Zuhörern in arge Bedrängnis. Dank der ihm eigenen charmanten Frömmigkeit und des Wohlwollens seiner Zuhörer zog er sich aus der Affäre. „Schließlich“, sagte er, „wären wir ja, wenn wir einer Meinung wären, auch Anhänger ein und desselben Glaubens.“ Als einer der Türken höflich bemerkte: „Es wird eine Zeit kommen, da wir miteinander übereinstimmen werden“, äußerte Palamas den freundlichen Wunsch, „solch eine Zeit möge bald kommen“.
Davon abgesehen, dass sie einander nicht besonders mochten, wussten Türken und Griechen, Muslime und Christen nicht viel übereinander. Anfangs wussten jene, die Palamas gefangen setzten, nicht einmal, wer er war – wussten nicht, dass er eine einflussreiche kirchliche Persönlichkeit auf dem sicheren Weg zur Heiligsprechung war, ja nicht einmal, dass er Orhans Verbündeten und Schwiegervater Kantakuzenos unterstützt hatte. Erst Orhans Leibarzt, der griechische Christ, setzte den Sultan davon in Kenntnis, wen sie da in ihrer Hand hatten und wie wichtig dieser Gefangene war. Wiederholt fragten die Muslime Palamas, wieso die Christen Mohammed nicht gelten ließen, da doch die Muslime die christlichen Propheten akzeptierten. Ismail führte das koranische Verständnis der Menschwerdung Christi an, das den Christen wie plumper Literalismus erschien. Doch Palamas brachte kaum mehr zustande. Er verfügte nur über rudimentäre Kenntnisse des Islam und wiederholte alte christliche Borniertheiten über Mohammeds Gewalttätigkeit und Wollust.
Doch Frieden und Versöhnung zwischen Gemeinschaften beruhen nicht auf solchen Dingen, sondern auf Mut und politischem Willen dazu, und über letzteren verfügten Sultan und Heiliger gleichermaßen. Jeder von ihnen war sich seiner öffentlichen Rolle bewusst. Indem Orhan persönlich den interreligiösen Dialog förderte, ließ er einen Topos herrscherlicher Souveränität aus dem zentralen Eurasien lebendig werden, für den wir von den Mongolen bis zu den Moguln zahlreiche Beispiele kennen. Palamas seinerseits erzählte seine Erlebnisse bei den Türken im Brief an die Thessalonicher als Allegorie auf das Leiden seiner Kirche, die selbst gefangen war, und auf das menschliche Leben unter der unergründlichen Gnade Gottes. Als Vorkämpfer des Glaubens geriet Orhan nicht ins Wanken, und trotz all der friedfertigen Güte von Palamas hatte er kein Interesse an religiösen Kompromissen oder an Synkretismus. 76Vielmehr kämpften Griechen wie Türken mit der unergründlichen Vorsehung, deren Wirken eine Art ontologische Doppeldeutigkeit darstellte. Palamas erlebte die Vorsehung als „abgründig“, wie sie sich in den ökologischen und demographischen Katastrophen manifestierte, welche die türkische Eroberung ebenso unvermeidlich wie unumkehrbar machten – mit seinen Worten, in „jenen Dingen von oben (ich weiß nicht, ob ich sie Züchtigung oder Preisgabe nennen soll), die unser Volk erlitten hat, und besonders das Erdbeben …“ 77Für manche Türken war die Eroberung indes eine Metapher für ihre Überlegenheit und Palamas’ Gefangenschaft „ein Beweis für die Wirkungslosigkeit“ des Christentums. 78
In der Folge ihrer Begegnung knüpften Palamas und die türkischen Eroberer enge Beziehungen an. So politisch nützlich sie offenkundig waren, erwuchsen sie doch auch aus gegenseitigem Respekt und einem nicht unvereinbaren sprituellen Erleben. Die klösterliche Gemeinschaft vom Berg Athos, die Heimat des Hesychasmus, blieb auch unter türkischem Schutz ein Fixpunkt christlicher innerer Einkehr und ein Ziel für christliche Almosen. 79Mochten die Moscheen der Türken oberflächlichen Triumphalisten auch als Sinnbilder für die Eroberung erscheinen, so waren sie doch zugleich sichtbare Metaphern für die gemischten Gemeinschaften, denen sie dienten, und spiegelten eine gemäß der Vorsehung gelebte gemeinsame Geschichte wider. Die berühmte Inschrift aus Bursa, in der sich Sultan Orhan Mudschahid und Gazi zugleich nannte, beginnt sogar mit der Einzigkeitssure 112 des Koran, die vollständig zitiert wird – eine kompaktere Zusammenfassung der islamischen Theologie kann es kaum geben –, und endet mit einem Segen, der mit dem doppelten Wortsinn der arabischen Wurzel sajd, die „Niederwerfung“ bedeutet, spielt. Eine Moschee (masjid) ist ein Ort der Niederwerfung, und wer „sich niederwirft“ (oder „eine Moschee errichtet“), sagt seinem Stolz ab.
Orhans Inschrift in Bursa
Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Sag: Er ist Allah, Einer, Allah der Urgrund. Er hat nicht gezeugt, und Er wurde nicht gezeugt. Und nie ist einer Ihm ebenbürtig gewesen. Datum: das Jahr 738 [1337–1338]. Mein Gott, sei dem Besitzer dieser Moschee gnädig, und dieser ist der große und gewaltige Emir, der Mudschahed auf dem Wege Allahs, der Sultan der Gazis, ein Gazi, der Sohn eines Gazis, der Recke des Staates und der korrekten Ritualpraxis, der Berühmte an den Horizonten, der Held des Glaubens, Orhan, der Sohn des Osman. Möge Allah seine Lebenszeit lange sein lassen! Er befahl die gesegnete Moschee um des Wohlgefallens Allahs willen. Wer eine Moschee errichtet, dem errichtet Allah ein Haus im Paradies. a
aÜbersetzung: Michael Reinhard Heß; Text der Inschrift nach der Textfassung in Ludvik Kalus: „L’inscription de Bursa au nom du sultan Orhān, datée de 738/ 1337–38: comment faut-il la lire?“, Turcica 36 (2004), S. 233–251, unter Berücksichtigung der von Howard benutzten Textvariante. Erstveröffentlichung des schwer entzifferbaren Textes in Mantran, „Les inscriptions arabes“, Nr. 1.
Читать дальше