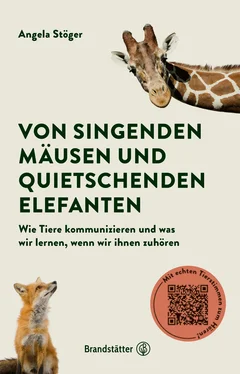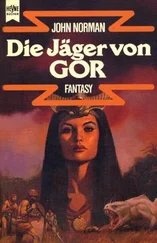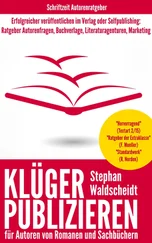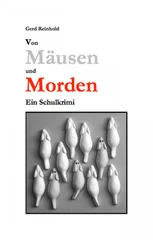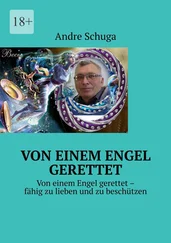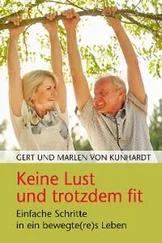Gehört werden – oder wie ein Lebewesen in seine Umwelt eingebettet ist
Die Größe eines Tieres, der hormonelle oder emotionale Zustand, all das beeinflusst die Eigenschaften der Stimme und den ausgestoßenen Laut – und beeinflusst damit auch den Empfänger. Um das Kommunikationssystem einer Tierart wirklich verstehen zu können, muss ich in meiner Forschung jeden einzelnen Aspekt berücksichtigen. Ich muss mich mit der Anatomie und Funktionsweise der schallproduzierenden Strukturen und Organe beschäftigen, mit allen internen Faktoren, die die Struktur des Lautes beeinflussen können, also das Alter und das Geschlecht des Tieres kennen, seinen hormonellen oder emotionalen Zustand beachten sowie auch gewisse kognitive Fähigkeiten, mit deren Hilfe das Tier die Lautstruktur modifizieren kann. Dank der Spektralanalyse, mit der sich dieses Spektrum von Frequenzen untersuchen lässt, kann ich dann herausfinden, welche Informationen über das Tier, über das lautgebende Individuum selbst in der akustischen Struktur des Lautes kodiert sind. Verlässt der Laut das Maul, den Schnabel oder den Mund, so wird er sofort durch die Umwelt verändert und mit zunehmender Entfernung abgeschwächt. Physikalische Mechanismen wie Schallreflexion oder Absorption wirken auf den Laut ein, atmosphärische und klimatische Bedingungen haben aber ebenso einen Einfluss wie der Lebensraum, das sogenannte Habitat, an sich. In der Savanne ist die Schallübertragung eine völlig andere als im dichten Regenwald.
Und was passiert dann, wenn der Laut mit all diesen Veränderungen von einem Artgenossen wahrgenommen wird? Die Antwort scheint simpel: Das Tier muss ihn hören, die Information verarbeiten und darauf reagieren. Kommunikation benötigt immer einen Sender und zumindest einen Empfänger. Es ist eine Interaktion zweier Lebewesen, und jedes beeinflusst das Verhalten des anderen. Aber wie wird der Empfänger reagieren? Es ist genau diese Reaktion, die ein ganz entscheidender Aspekt in der Kommunikation ist. Denn diese Reaktion wirkt als Feedback zurück auf den Sender. Ist ein Paarungsruf etwa besonders attraktiv und zeigt an, wie stark und groß das Männchen ist, wird das Weibchen sich eher dazu entschließen, sich anzunähern, als bei einem Paarungsruf, der gewisse Schwächen aufweist, salopp gesagt also weniger sexy ist. Die Lautproduktion ist nämlich sehr energieaufwendig. Wenn Männchen in der Paarungszeit oft und kontinuierlich Rufe produzieren, gelingt es nur den Stärksten, eine gewisse Lautstärke und Energie in der Stimme aufrechtzuerhalten. Evolutionär haben derartige Fähigkeiten einen gewaltigen Einfluss auf den Sender, in unserem Fall auf das Männchen, weil sich die Eigenschaften der erfolgreichen Individuen häufiger fortpflanzen als jene der unterlegenen.
Als Bioakustikerin sitze ich demnach nicht „nur“ mit meinem Mikrofon im Wald oder in der Savanne, am Tümpel oder vor einem Erdloch und warte mehr oder weniger geduldig darauf, dass ein Tier vokalisiert, sondern ich arbeite mit sehr diversen und vielfältigen Methoden – im Labor genauso wie im Freiland. Ich untersuche die Anatomie und Morphologie der schallproduzierenden Organe, ich sammle Kotproben für Hormonanalysen, verbringe viel Zeit vor dem Rechner, um die Struktur von Lauten zu analysieren, und tüftle an Experimenten, um Hypothesen zu verifizieren.
Ich beschäftige mich aber auch mit dem Hörvermögen der Tiere. Zur Bestätigung, dass etwa ein gerade entspannt fressender Elefant einen interessanten Laut wahrgenommen hat, muss er innehalten und die Ohren leicht abspreizen. Nur unter Einbeziehung dieser Beobachtung kann ich bei Experimenten auch wirklich feststellen, ob die Tiere ein Geräusch wahrgenommen haben oder nicht. Erkenntnisse darüber, wie und was Tiere hören, in welchen Frequenzbereichen sie besonders sensibel sind, sind derzeit wichtiger denn je, wenn wir verstehen wollen, welcher Lärm welche Tiere stört. Denn wir Menschen verpesten die Umwelt mit Lärm. Er ist eines der universellen Umweltprobleme – an Land wie auch im Wasser.
Grenzenloser Schall macht Stress
Lärm hört nicht an der Grenze zu einem Nationalpark auf. Da helfen auch keine Schallschutzmauern. Durch sie wäre vielmehr die Grenzmobilität, auf die viele Tiere angewiesen sind, eingeschränkt. Manche Frequenzen des menschengemachten Lärms – vor allem die tiefen – haben eine riesige Reichweite, Verkehrslärm ist zum Beispiel sehr tieffrequent. Windparks zur Stromerzeugung produzieren auch Infraschall, jene Schallanteile des Frequenzspektrums, die für uns Menschen zu tief sind, dass wir sie hören. Welche Tiere diesen tieffrequenten Störlärm wahrnehmen und ob es ihre Leben beeinflusst, wissen wir noch nicht mit Sicherheit.
Tiere gewöhnen sich natürlich an Lärm, genauso wie Menschen. Es sei denn, es handelt sich um eine Lautstärke, die schädigt oder stört, dann versuchen sie ihr Verhalten anzupassen oder wandern ab, wenn dies möglich ist. Aber selbst wenn „nur“ lärmende Menschen durch den Wald gehen, kann das sehr schädlich sein und Stress bei den Tieren erzeugen. Besonders im Winter, wenn die Tiere mit ihrem Energievorrat gut haushalten müssen oder in Winterruhe sind.
Tembo spüren und die Technik
Um solche Auswirkungen zu ermessen, hilft uns heute laufend weiterentwickeltes technisches Equipment. Die Mikrofone werden handlicher, die Computer leistungsfähiger. Wir arbeiten viel mit Elefanten, deren tiefste Frequenzanteile im Infraschallbereich unter zwanzig Hertz liegen, so tief, dass ich sie als Mensch nicht wahrnehmen kann. Diese Rumble-Laute haben aber auch Schallanteile im für uns Menschen hörbaren Bereich – man kann sie aber nur wahrnehmen, wenn man sich in unmittelbarer Nähe zum Elefanten befindet. Das liegt daran, dass diese höheren Frequenzen bei der Schallübertragung relativ schnell abgeschwächt werden. Stehe ich aber neben einem „rumbelnden“ Elefanten, kann ich sogar die tiefen Frequenzen wahrnehmen. Ich kann sie natürlich immer noch nicht hören, aber ich kann die Schwingungen mit meinem Körper fühlen.
Diese besondere Erfahrung durfte ich 2014 in Südafrika machen, bei Elefanten, die in menschlicher Obhut gehalten werden. Unter diesen Elefanten befand sich Tembo, ein vierunddreißigjähriger Bulle, 3,4 Meter Schulterhöhe, etwa sechstausend Kilogramm schwer – ein mächtiges Tier. Tembo war ein sogenannter Problemelefant, er war häufig aus dem Nationalpark ausgebrochen und hatte Bauern belästig, weil er eine Vorliebe für Zuckerrüben und Orangen entwickelt hatte. Um ihn vor einem Abschuss zu bewahren, hatte man begonnen, ihn zu trainieren. Heute ist er ein Botschafter seiner Art, um auf die Probleme im Zusammenleben zwischen Wildtieren und Menschen aufmerksam zu machen.
Zum Zeitpunkt meines damaligen Besuchs hatte ich mich schon einige Jahre mit Elefanten beschäftigt und war vor Ort, um Tonaufnahmen zu machen. Als ich mit Tembos Pfleger und meinem langjährigen Kollegen Anton Baotic am Gelände stand und wir das Projekt besprachen, beschloss Tembo, sich uns aus der Nähe anzusehen. Er kam auf uns zu, weil er seinen Pfleger erkannt hatte. Tembo blieb etwa einen Meter vor uns stehen – es war ein beeindruckendes Gefühl, diesem wunderschönen Elefanten so nahe zu sein, ohne Barriere zwischen uns. Der Pfleger tätschelte ihn zur Begrüßung am Bein und Tembo öffnete das Maul und antwortete mit einem mächtigen Rumble-Laut. Ich konnte den Laut spüren – ich konnte ihn auch hören, weil wir so nahe waren –, aber vor allem habe ich ihn gespürt. Berührt man einen Elefanten während der Lautäußerung, so spürt man die Vibrationen am ganzen Körper des Tieres. Der tiefe Schall geht durch seinen Körper und den eigenen hindurch.

Forschungsbesprechung im Nationalpark in Südafrika
Читать дальше