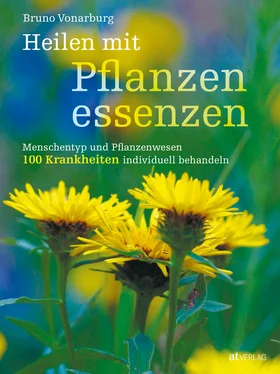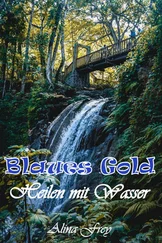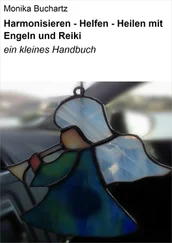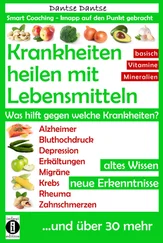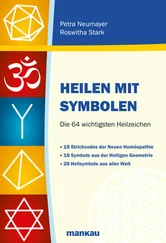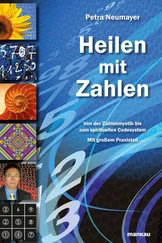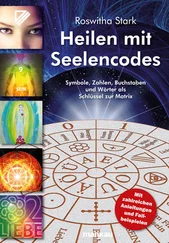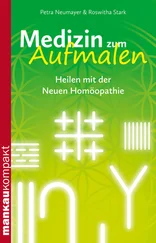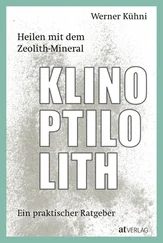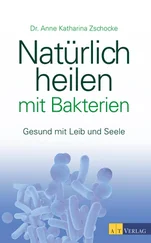Königin der Nacht (Selenicereus grandiflorus Britton et Rose): Wenn Heuschnupfen mit einem beklemmenden Gefühl bei der Atmung, mit Brustenge, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen und Gesichtsröte einhergeht, ist der Einsatz der Königin der Nacht angezeigt. Sie hilft Patienten, die unter Stress stehen, alles in sich hineinfressen und sich körperlich und seelisch eingeengt fühlen.
Meisterwurz (Peucedanum ostruthium Koch) wird zur Prophylaxe gegen Heuschnupfen eingesetzt oder wenn die allergische Erkrankung zu massiver Entkräftung führt. Die Betroffenen besitzen wenig Widerstandskraft und lassen sich von der Erkrankung völlig aus der Fassung bringen. Ihr Durchhaltevermögen ist bereits bei geringsten Beschwerden eingeschränkt. Hier hilft die Meisterwurz. Sie strotzt vor Energie und beeindruckt mit ihren majestätisch aufrecht stehenden, strahlend weißen Blütenständen. Dieses Kraftpotenzial überträgt sie auf Heuschnupfenkranke.
Pestwurz (Petasites hybridus L.): Diese Pflanze wurde für die Behandlung von Heuschnupfen neu entdeckt. Sie hemmt gewisse Botenstoffe, die sogenannten Leukotriene, die Allergiesymptome auslösen, und hemmt die Mastzellen in ihrer Histaminproduktion. Die Arznei wird oft eingesetzt, wenn der Heuschnupfen zu psychischer und physischer Anspannung führt, die festsitzt und nicht entladen werden kann. Die Betroffenen fühlen sich mit ihren krampfartigen Beschwerden auf der Brust, im Kopf oder im Magen beengt wie in einem verschlossenen Dampfkochtopf.

Stockmalve wirkt als Schutzmantel bei gereizten Schleimhäuten und Heuschnupfen.
Die tägliche Einnahme von 1 Teelöffel Bienenhonig (nicht bei Diabetes) oder Blütenpollen aus der näheren Umgebung dient ebenfalls zur Prophylaxe. Schweinefleisch, tierische Fette, zu viel Salz, weißen Zucker und Weißmehl sollten Heuschnupfenpatienten vermeiden. Bisweilen hilft auch der Verzicht auf Milch, den Allergendruck zu verringern. Nahrungsmittel mit künstlichen Zusätzen sollten gemieden werden. Zur Linderung der Beschwerden bewähren sich auch eine Entgiftungs- oder Entsäuerungskur wie im ersten Kapitel beschrieben.
Darmsanierung: Man weiß heute, belegt durch wissenschaftliche Studien, dass allergisches Geschehen und Darmgesundheit in einem direkten Verhältnis zueinander stehen, da sich 80 Prozent der Immunzellen im Darm befinden. Bei Kindern mit genetischer Vorbelastung kann die Ausbildung und Ausreifung des Immunsystems bereits ab dem ersten Tag nach der Geburt mit dem Mittel Omni Biotic Panda (Beloga/Allergosan) unterstützt werden. Erwachsenen empfiehlt sich eine Darmsanierung.
Heuschnupfenpatienten reagieren oft empfindlich auf die in der Umwelt verbreiteten niederen Pilze, die ihre Schleimhäute beeinträchtigen. Zur Neutralisierung empfiehlt sich die Behandlung mit dem isopathischen Mittel Ruberkehl der Firma Sanum, wovon abends 5 Tropfen (Kinder: 3 Tropfen; Kleinkinder: 1 Tropfen) in Wasser verdünnt eingenommen werden.

SCHNUPFEN
(Rhinitis)
Täglich sind wir einer Vielzahl von Viren, Bakterien, niederen Pilzen und anderen pathologischen Keimen ausgesetzt, ohne dass wir dabei krank werden. Sind jedoch die körpereigenen Abwehrkräfte geschwächt, können sich die mikroskopisch kleinen Krankheitserreger vorwiegend in den Schleimhäuten des Atemtraktes festsetzen. Das günstige Milieu mit Feuchtigkeit und Körperwärme verleiht den Eindringlingen die nötige Kraft, sich massenhaft zu vermehren und entzündliche Reaktionen auszulösen.
Die Schleimhauttapete des Nasenraums bildet diesbezüglich die primäre körperliche Eintrittspforte, in der sich die Infektionserreger einnisten können, was sich als Schnupfen (abgeleitet vom althochdeutschen snuppen , »putzen«) bemerkbar macht. Mit dem reinigenden Nasenfluss werden die eingedrungenen Krankheitserreger nach außen befördert.
Medizinisch wird das Beschwerdebild als Rhinitis (abgeleitet vom griechischen rhino, »Nase«) bezeichnet. Rund 70 Prozent der Erwachsenen in unseren Breitengraden erkranken mindestens 1- bis 3-mal jährlich an Schnupfen. Kleinkinder und Säuglinge bis zu 8-mal. Sie reagieren empfindlicher, da bei ihnen die Immunreaktionen noch nicht vollständig entwickelt sind.
Viren, hauptsächlich Rhinoviren, von denen über 100 Arten bekannt sind – infolge dieser Vielfalt existiert kein Impfstoff –, gelten als Auslöser. 90 Prozent der Fälle werden durch Tröpfchenübertragung mit dem Niesen, Husten oder Sprechen von Mensch zu Mensch verbreitet. Die Inkubationszeit nach der Ansteckung beträgt einige Stunden bis zu 2 Tage.
Unterschieden werden mehrere Schnupfenarten, so der virale Erkältungsschnupfen, der entweder trocken oder mit wässrigen bis schleimigen Sekreten auftreten kann, der Sekundärschnupfen, bei ihm sind nicht nur Viren, sondern auch Bakterien mitbeteiligt, der toxisch irritative Schnupfen, der von Gasen und Dämpfen aus gelöst wird, der hormonelle Schnupfen, der mit hormonellen Schwankungen in der Schwangerschaft, Stillzeit oder in den Wechseljahren im Zusammenhang steht, der medikamentöse Schnupfen (Rhinitis oder Privinismus medicamentosa), der durch Nebenwirkungen von Medikamenten hervorgerufen wird, und letztlich der allergische Schnupfen, bei dem Allergene wie Pollen, Staub und Milben eine auslösende Rolle spielen.
Oft kann der Schnupfen, auch Coryza (griechisch koryza, »Erkältung«) genannt, eine Nebenerscheinung einer anderen Erkrankung wie Grippe, Bronchitis, Mandelentzündung, Sinusitis, Kehlkopf- oder Rachenentzündung sein. Allgemein dauert er etwa 1 Woche. Im Volksmund sagt man: »3 Tage kommt er, 3 Tage bleibt er, 3 Tage geht er.« Dauert er länger an, entwickelt sich aus einem akuten ein chronischer Schnupfen.
Die nur unter dem Elektronenmikroskop sichtbaren Keime in der Größe eines millionstel Millimeters sind rund 300-mal kleiner als bakterielle Erreger und besitzen die Fähigkeit, durch winzig kleine Poren der Nasenschleimhaut einzudringen. Erst in neuerer Zeit gelang es Wissenschaftlern am englischen Schnupfenforschungszentrum in Salisbury, das Virus zu isolieren und zu kultivieren. Dabei zeigte sich, dass der Erreger eine enorme Zählebigkeit besitzt und tiefsten Temperaturen widerstehen kann. Damit ist er imstande, über eine längere Zeit aktiv zu bleiben.
Bei einer Ansteckung stören diese Viren das Gleichgewicht der natürlich gesunden Bakterienflora der Nasenschleimhaut und begünstigen so den Ausbruch einer Superinfektion, wobei sich in 10 Prozent der Fälle nicht nur die pathologischen Viren, sondern auch Bakterien massenhaft vermehren. Diese Sekundärinfektion bedarf der sorgfältigen Therapie, da sie sich sonst im Organismus weiterverbreiten kann.
BESCHWERDEBILD
Im Anfangsstadium kitzelt es in der Nase, dann tritt das lästige Niesen ein, gefolgt von wässrigem oder schleimigem Nasenausfluss – es wird geschnieft und gehustet, was das Zeug hält.
Der Körper reagiert auf die krankhaften viralen Eindringlinge mit einer verstärkten Aktivität der Abwehrzellen, die dafür sorgen, dass die Schleimhäute anschwellen und stärker durchblutet werden. Es werden Sekrete produziert, damit die pathologischen Keime wieder nach außen befördert werden können. Bei all diesen Reaktionen handelt es sich um körpereigene Maßnahmen, die man nicht bekämpfen, sondern eher unterstützen sollte. Durch das Anschwellen der Nasenschleimhaut besteht das Gefühl einer verstopften Nase mit beengter Atmung. Je nach Stärke der Infektion entzünden sich auch die Augen (Konjunktivitis), der Tränenfluss vermehrt sich, und es machen sich Geruchsstörungen, Benommenheit, Kopfschmerzen und Abgespanntheit bemerkbar. Vereinzelt stellen sich Gliederschmerzen ein.
Читать дальше