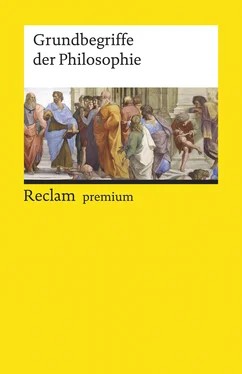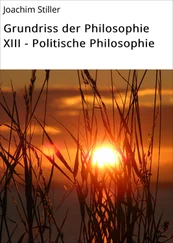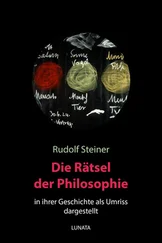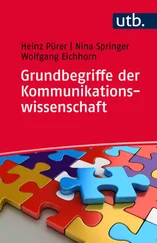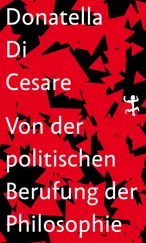Die zweite Version der kognitivistischen Sichtweise ist formaler Art . Sie beruft sich jeweils auf ein methodisches VerallgemeinerungsprinzipPrinzip, das die entscheidenden Kriterien für die Findung der objektiv gebotenen MoralMoralnormen bereitstellen soll. Besonders einflussreiche Varianten dieser formalen Version sind die Goldene Regel (›Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu‹) und KantKant, Immanuels Kategorischer ImperativKategorischer Imperativ »Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde« ( Grundlegung zur Metaphysik der Sitten , 1785). Ethik
Allerdings führen diese methodischen PrinzipPrinzipien in manchen Fällen, beim Wort genommen, zu keinen oder zu abwegigen Ergebnissen. Dazu stellt sich auch hier die an [92]jede kognitivistische E. gerichtete Frage, auf welche Weise man das betreffende VerallgemeinerungsprinzipPrinzip als obersten Maßstab der MoralMoralbegründung erkennen kann. Unzureichend ist die häufige Antwort, das PrinzipPrinzip sei bereits im BegriffBegriff der MoralMoral enthalten. Denn selbst wenn dies zutrifft, bleibt für das IndividuumIndividuum immer noch die Frage: Warum ist es rational für mich, die Normen, die aus der gängigen Verwendung des Wortes ›MoralMoral‹ ableitbar sind, als Verhaltensmaßstab zu akzeptieren? Ethik
Der ethische Nonkognitivismus hält eine ErkenntnisErkenntnistheorie dem Menschen vorgegebener Normen oder PrinzipPrinzipien nicht für möglich. Auch er bringt Probleme mit sich. Dies gilt besonders für eine extreme Form des Nonkognitivismus, der zufolge eine MoralMoralnorm lediglich eine willkürliche WerteWertentscheidung (→Werte) ihres Vertreters widerspiegelt. Es hätte langfristig schlimme Auswirkungen auf unsere Lebenspraxis, wenn wir zu dem Schluss kommen müssten, dass auch jene MoralMoralnormen, die wir alle im Alltag für unverzichtbar halten – z. B. das Verbot von willkürlicher Gewaltanwendung – in keiner Weise begründbar sind. Ethik
Eine gemäßigte Form des Nonkognitivismus trägt diesem Einwand Rechnung, indem sie davon ausgeht, dass es elementare Interessen gibt, wie etwa das Überlebensinteresse oder das Interesse an körperlicher Unversehrtheit, die praktisch jedes IndividuumIndividuum hat, und dass diese Interessen durch die soziale Geltung gewisser Normen einer KernmoralMoral, wie des Tötungsverbots oder des Verbots von Gewaltanwendung, wirksam geschützt werden. Für jeden Einzelnen sind danach die Vorteile dieser Verbote (der eigene Schutz) größer als die Nachteile (der Verzicht auf die betreffenden HandlungenHandeln). Insofern sind diese und ähnliche [93]Verbote, wenn auch nicht objektiv, so doch in hohem Maße intersubjektiv begründet: Es ist rationalVernunft für jeden Einzelnen, der die betreffenden Interessen hat, sich für die soziale Geltung einer solchen KernmoralMoral unter den MenschMenschen auszusprechen und einzusetzen.
Der Vorteil dieser Auffassung von MoralMoralbegründung ist, dass es ihr auch ohne fragwürdige erkenntnistheoretischeErkenntnistheorie Voraussetzungen gelingt, die MoralMoral vor bloßer Willkür zu bewahren. Der Nachteil wird häufig darin gesehen, dass diese Auffassung in Wahrheit eine jedem IndividuumIndividuum gleicherweise dienende KernmoralMoral gar nicht begründen kann. So sei nicht einzusehen, warum die Mehrheit der Bürger auf der Basis eigener Interessen nicht gewissen Minderheiten, die ihr machtmäßig unterlegen sind, den gleichberechtigten Schutz durch die genannten Normen verweigern soll. Es gebe hierfür in Geschichte und Gegenwart ja genügend Beispiele. Ethik
Eine in jedem Fall befriedigende Antwort auf diesen Einwand hat der Nonkognitivist nicht. Trotzdem kann er auf verschiedene Umstände hinweisen, die auch auf der bloßen Basis von Interessen gegen eine Diskriminierung von Minderheiten sprechen können. Erstens kann nicht selten eine Mehrheit, jedenfalls langfristig gesehen, mehr von der Kooperation mit einer Minderheit als von ihrer Unterdrückung profitieren. Und zweitens ist nicht ausgeschlossen, dass Mitglieder der Mehrheit auch Interessen altruistischerAltruismus Art haben, die eine Diskriminierung verbieten. Was aber die Beispiele aus Geschichte und Gegenwart angeht, so ist zu bedenken: Nicht alles, was Menschen de facto tun, liegt auch in ihrem wahren, d. h. aufgeklärten Interesse. Ethik
Norbert Hoerster
[94]Dieter Birnbacher: Analytische Einführung in die Ethik. Berlin / New York 2003. 32013.
Norbert Hoerster: Wie lässt sich Moral begründen? München 2014.
John Leslie Mackie: Ethik. Die Erfindung des moralisch Richtigen und Falschen. Stuttgart 1986.
Peter Singer: Practical Ethics. Cambridge [u. a.] 1979. – Dt.: Praktische Ethik. Stuttgart 1984. 32013.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.