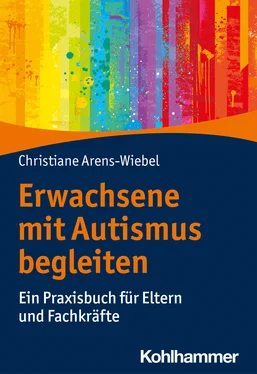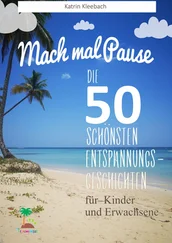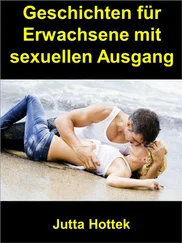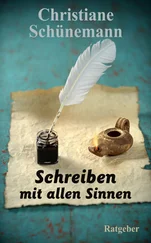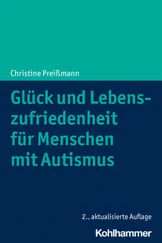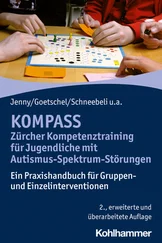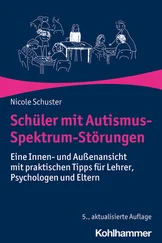Christiane Arens-Wiebel
Autismus ist eine schwerwiegende Beeinträchtigung. Autismus besteht von Geburt an, die ersten Anzeichen müssen bis zum dritten Geburtstag aufgetreten sein, um die Diagnose »Frühkindlicher Autismus« stellen zu können. Auch wenn die Diagnosestellung häufig erst im Vorschulalter oder später erfolgt, so ist bei einem Menschen mit Autismus von Anfang an etwas anders, was ihn sein Leben lang begleiten und beeinträchtigen wird. Daher genießt das autistische Kind schon frühzeitig besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge durch seine Eltern, wird bestenfalls bereits als Kleinkind zu Therapien gebracht, und seine Eltern versuchen, Förder- und Erziehungsratschläge zu Hause umzusetzen. Das Kind wird in einer integrativen Kindertagesstätte oder einem speziellen Kindergarten gefördert und erhält dort begleitend Therapien bzw. spezielle Angebote. Auch in der Schulzeit besteht weiterhin ein intensives Förderangebot. Der Alltag und das Leben zu Hause werden spezifisch auf dieses Kind ausgerichtet. Das Kind (und später der/die Erwachsene) mit Autismus-Spektrum-Störung ist ein besonderer Mensch, auf den übliche pädagogische Konzepte nicht anzuwenden sind. Daher fragen sich die Bezugspersonen immer wieder, ob sie alles richtig machen, und was sie mglw. anders machen könnten oder sollten. Einen Menschen mit Autismus zu verstehen und ihn fördernd zu begleiten, ist eine Herausforderung und fordert von der Umwelt große Empathie, pädagogisches Geschick, Kreativität, aber auch Konzepte, um z. B. eine strukturierte Beschäftigung oder einen ebensolchen Tagesplan anzubieten. Hierfür ist notwendig, Autismus zu verstehen, sich erklären zu können, warum sich der Mensch in diesem Moment so verhält, zu begreifen, wie er wegen des Autismus am besten lernen kann, zu spüren, wenn gerade nichts mehr geht, und geduldig und gelassen zu bleiben, wenn etwas einmal nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt.
Das, was in der Kindheit so wichtig war, setzt sich im Erwachsenenalter fort. Lebenslange Förderung ist das Ziel, gepaart mit Integration in die Gesellschaft in den Bereichen Arbeit bzw. Beschäftigung, Wohnen und Freizeit. Die Aufgabe von Angehörigen und Betreuer*innen ist, die Bedingungen bzw. den Rahmen dafür zu schaffen, dass der beeinträchtigte Mensch sich besser anpassen und in eine Gruppe bzw. Institution integrieren kann. Dazu gehört, für Strukturen und Klarheit zu sorgen, Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit, Ruhe und Beharrlichkeit zu gewährleisten und sich insbesondere um eine autismusfreundliche Kommunikation zu bemühen. Hier ist der Menschen mit Autismus auf Unterstützung des Umfelds angewiesen. Ein junger Mensch hat mit Abschluss der Schulzeit noch nicht ausgelernt, und es kann sich noch viel verändern und entwickeln. Auch der älter oder alt werdende Mensch mit Autismus ist noch förderbar. Entwicklung funktioniert jedoch nur, wenn dem Menschen entsprechende, auf ihn persönlich zugeschnittene Angebote gemacht werden – hierauf ist er angewiesen.
Im vorliegenden Buch wird beschrieben, was in der Phase des Erwachsenseins, die nach der Kindheit die deutlich längere Lebensspanne ist, sinnvoll und notwendig ist, um die Integration autistischer Menschen in Einrichtungen zu erleichtern und den Betroffenen und ihren Mitbewohner*innen und Kolleg*innen eine gute Lebensqualität zu ermöglichen. Es wird auch über die Rolle der Eltern und deren besondere Verantwortung und Fürsorge ihrer autistischen Tochter/ihrem autistischen Sohn gegenüber geschrieben, und wie sie gut damit umgehen können. Das Buch beschreibt ungefähr 50 Lebensjahre im Leben eines autistischen Menschen, und bezieht dabei die Rollen seiner Herkunftsfamilie, seiner Betreuer*innen, Kolleg*innen und Mitbewohner*innen ein. Die Darstellung endet am Lebensende, d. h., abschließend wird das höhere Lebensalter beschrieben, denn gerade beim älter werdenden Menschen mit Autismus gibt es Besonderheiten, wie für ihn der letzte Lebensabschnitt mit größtmöglicher Lebensqualität gestaltet werden kann. Zu allen Themen gibt es bisher nur vereinzelte Studien bzw. Berichte, da Autismus nicht im Fokus bspw. der Altersforschung steht. Es gibt jedoch viele Veröffentlichungen zum Bereich der geistig Behinderten – die Erkenntnisse hieraus können modifiziert bzw. autismusspezifisch angeglichen größtenteils auch auf autistische Menschen übertragen werden.
Zur besseren Übersichtlichkeit und praktischen Verwendbarkeit habe ich das Literaturverzeichnis in Kategorien aufgeteilt. Diese enthalten weiterführende Bücher, aber auch Links zu hilfreichen Internetseiten, zum Teil auch mit kurzen Filmen.
Fallbeispiele, die aus meiner langjährigen Tätigkeit als Therapeutin und Beraterin entstanden sind, sind im Text gekennzeichnet durch einen blauen Balken am linken Rand.
2
Übergang zwischen Kindheit und Erwachsensein
Menschen im Autismus-Spektrum verfügen (so wie Menschen allgemein) über ein individuelles sprachliches und kognitives Niveau und ganz unterschiedliche Fähigkeiten, aber auch Interessen. Es gibt Betroffene mit schwach und Betroffene mit stark eingeschränkten Fähigkeiten und daraus resultierenden Möglichkeiten. Es finden sich Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten wie massiven Stereotypien, selbstverletzenden Verhaltensweisen, fremdaggressivem Verhalten, Verweigerungen, minimaler Aufmerksamkeitsspanne, erheblicher Beeinträchtigung der Kommunikation und sehr geringen Fähigkeiten der Selbstständigkeit, dies insbesondere unter den stark kognitiv beeinträchtigten Menschen. Andere autistische Menschen verfügen über eine vollständige Sprache, sind intellektuell nur leicht beeinträchtigt, besitzen bspw. kulturtechnische Fähigkeiten und sind sehr selbstständig. Sie sind sich ihrer Beeinträchtigung bewusst und verlangen, sehr genau an ihrer persönlichen Zukunftsplanung und Lebensgestaltung beteiligt zu werden. So unterschiedlich Menschen im Spektrum sind, so variabel und individuell sind die Erfordernisse an ihre Zukunft. Das Ziel ist immer eine Ausbildung und spätere Beschäftigung auf einem angemessenen Niveau, die persönlichen Stärken und Interessen berücksichtigend. Dies lässt sich allerdings nur mit großem Einsatz insbesondere der Eltern und einer intensiven Mitwirkung der Lehrer*innen, der zukünftigen Ausbilder*innen und wohlwollender Zusammenarbeit mit der Reha-Beratung bewerkstelligen.
2.1 Das Ende der Schulzeit
In Deutschland ist die Schulpflicht einschließlich der Anzahl der Schulbesuchsjahre aufgrund der Kulturhoheit der Länder in den einzelnen Landesverfassungen geregelt. Jede/jeder autistische Schüler*in geht neun bis zwölf Jahre in die Schule, wird integrativ bzw. inklusiv beschult oder besucht eine Förderschule bzw. eine Tagesbildungsstätte. Dabei gibt es unterschiedliche Konzepte für die Abschlussjahre und den Übergang in einen (vor-)beruflichen Bereich. In den Abschlussjahrgängen ist es wichtig, den/die Schüler*in auf das Leben nach der Schulzeit vorzubereiten. Schwerpunkte der Förderung des/der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sind die Vermittlung von sozialen, lebenspraktischen und berufsbezogenen Kompetenzen sowie die Stärkung der Ich-Identität. Die Inhalte und Ziele des Unterrichts sollten sich an den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen des/der jeweiligen Schüler*in auf der Grundlage des Lehrplans orientieren. Vorhandene Fertigkeiten werden aufgegriffen und vertieft. Inhalte und Ziele des Unterrichts richten sich an die Anforderungen des Erwachsenenlebens in den Bereichen Arbeiten, Wohnen, Freizeitgestaltung und soziales Leben. Hierzu gehören Einzelfähigkeiten wie z. B. das Lesen von Fahrplänen, Rechnen mit Geld, einkaufen, saubermachen, Wäsche pflegen sowie Themen wie Kennenlernen verschiedener Wohnformen, Öffentlichkeit (Behörden), Gesundheitsfürsorge, Ernährung und der Umgang mit Medien. Der Lehrplan hängt dabei von der besuchten Schulform ab, also ob sich der junge Mensch bspw. in einer Schule für Körperbehinderte, einer Tagesbildungsstätte oder in einer integrativen oder inklusiven Schule befindet. Die letzten Schuljahre bilden eine wichtige Grundlage für den weiteren Weg des jungen Menschen. In dieser Zeit können intellektuelle Fähigkeiten, Selbstständigkeitsfertigkeiten sowie Verhaltensverbesserungen erreicht werden. Mit deren Hilfe wird eine positive Integration in eine Einrichtung der Berufsorientierung und Arbeit wahrscheinlicher.
Читать дальше