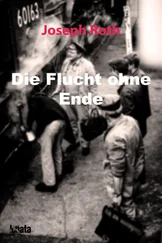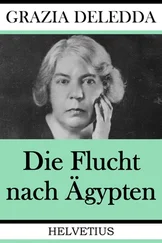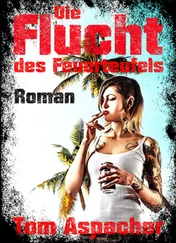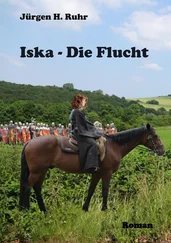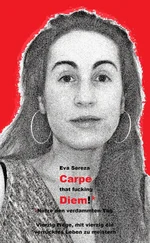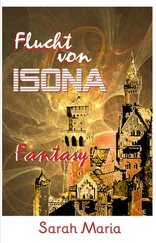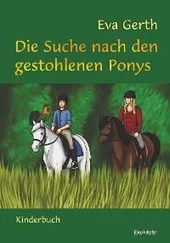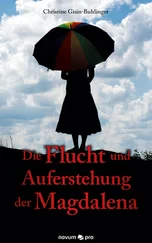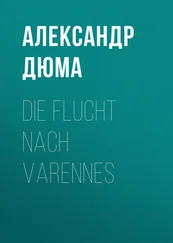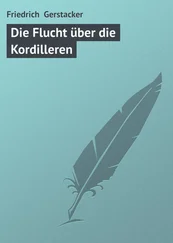„ob Haß und Haßbereitschaft in Deutschland tatsächlich überwunden sind, nachdem ihre nach allen Seiten wütenden, zerstörerischen Folgen offenbar wurden. Seelische Erkrankung kann nicht durch Stillschweigen überwunden werden. Sie ins Bewußtsein zu heben, und so ihre Ursachen bannen zu helfen, ist dieses Buch geschrieben worden.“ 3
Ausgangspunkt ihrer Überlegungen bildet die Frage, ob die Emanzipation der Juden in Deutschland als ein gescheitertes Experiment anzusehen sei. Ihr Buch gibt darauf eine klare, nämlich ablehnende Antwort: Es handele sich gar nicht um eine Auseinandersetzung mit Inhalten und Folgen der jüdischen Emanzipation, sondern es gehe ausschließlich um die Funktion der antisemitischen Propaganda für die nationalsozialistische Bewegung. Aus einem historisch-soziologischen Blickwinkel rekonstruierte Reichmann, dass es im 19. Jahrhundert noch eine „objektive“ und eine „subjektive Judenfrage“ in den europäischen Ländern gegeben habe. Objektiv waren vor der Gleichstellung soziale und kulturelle Unterschiede zwischen Juden und NichtJuden vorhanden. Nach der Emanzipation habe jedoch in einigen europäischen Ländern die „objektive Frage“ keinen Anlass mehr für gesellschaftliche Auseinandersetzungen gegeben, so unter anderem in Deutschland oder auch in Großbritannien, in anderen dagegen schon, etwa in Polen oder Russland. In Deutschland sei im 20. Jahrhundert ausschließlich die „subjektive Judenfrage“ ausschlaggebend für den Aufstieg des Nationalsozialismus gewesen. Diese „unechte Frage“ bzw. ihre politische Funktionalisierung bilden den zentralen Punkt in Eva Reichmanns Analyse. Sie bezeichnet mit diesem Begriff gesellschaftliche Diskussionen, in denen vor allem in Krisenzeiten individuelle „Unlustgefühle“ formuliert werden. Diese Gefühle entstehen nach Freud aus der zivilisatorischen Erziehung, die den Aggressionstrieb unterdrückt. Je heftiger Unlustgefühle auftreten, desto stärker fühlt sich das Individuum in seiner eigenen Existenz und Identität bedroht. Juden als Gruppe bildeten dabei unabhängig von konkreten Personen ein besonderes Angriffsobjekt, weil ihnen sowohl Ähnlichkeit als auch Andersartigkeit zugesprochen wurde, wobei Juden von Nicht-Juden als sicher in ihrer Identität wahrgenommen werden – auch wenn diese selbst sich nicht so sehen. Eva Reichmann bezieht sich in ihrer Analyse auf Freuds Überlegungen zum Unheimlichen, bleibt jedoch nicht auf der Ebene des Individuums stehen, sondern fragt nach den gesellschaftlichen Ursachen für „Unlustgefühle“ gegen Juden. Neben ökonomischen Ungleichheiten, die in der noch vorhandenen besonderen Berufsstruktur der jüdischen Minderheit liegen, der zunehmenden Erschütterung religiöser Wertsysteme (Säkularisierung) sowie einem aggressiven Nationalismus (insbesondere in Deutschland) benennt Reichmann auch die daraus entstandene „Schwächung des Gewissens“ als eine kollektive gesellschaftliche Erscheinung in Zeiten der Krise. Der Nationalsozialismus habe schließlich erfolgreich die Möglichkeiten der Demokratie nutzen können, um für eine antirationale, aggressive und antidemokratische Politik zu werben.
Eva Reichmann benennt also zwei Verantwortliche für den Aufstieg des Nationalsozialismus: die politischen Führer der NS-Bewegung und die „Massen“, die lieber einer gefühlsorientierten Ideologie folgten, als sich vernunftgeleitet mit Krisenprozessen auseinanderzusetzen. Es ist offensichtlich, dass sich Eva Reichmann mit dem letzten Argument im Nachkriegsdeutschland nur wenige Freunde machte, denn sie ließ die einseitige These von der Verführung der Massen durch diabolische Verführer nicht gelten, sondern betonte im Gegenteil die Verantwortlichkeit der Menschen, die zur Masse wurden. Es war Zweck ihrer Tätigkeiten, auch ihres Buches, einen gesellschaftlichen Prozess des Nachdenkens anzuregen, um aus dieser Reflexion zur Verantwortung gegenüber der Vergangenheit zu gelangen. Den Erfolg des Nationalsozialismus führte sie auf die eigenartige politische, soziale und ökonomische Umbruchsituation in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zurück, deren destruktive Potentiale aber erst durch die „Befreiung der Triebe“, also eine Flucht der sich sozial und politisch deklassiert Fühlenden in den Hass auf „den Juden“, virulent wurden. Ihr Buch ist daher viel mehr als nur ein Beitrag zur Antisemitismusforschung – es behandelt eigentlich die deutsche Gesellschaftsgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts aus soziologischer und gruppenpsychologischer Perspektive.
Ihre Analyse deckt sich in manchen Teilen mit den Untersuchungen der exilierten Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, vor allem mit deren Untersuchungen zur autoritären Persönlichkeit. Auch die Arbeiten von Leo Löwenthal zur Funktion von Propaganda standen im Hintergrund. 4Die Auswertungen dieser Experimente erschienen nach der englischen Version von Reichmanns Buch, sie verwies aber explizit auf diese in der deutschen Ausgabe. Wie die Vertreter der kritischen Theorie befasste sich auch Reichmann letztlich mit den Schwierigkeiten von Individuen, in modernen und sich schnell verändernden, demokratischen Gesellschaften Orientierung zu finden. Gerade deshalb sei die Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit auch so wichtig, denn erst die aktive Anerkennung, einen Irrweg eingeschlagen zu haben, ermögliche Umkehr und einen Bewusstseinswandel. 5
In akademischen Kreisen fand das Buch von Eva Reichmann überwiegend Anklang und Zustimmung, ebenso in Gruppen des deutschjüdischen Exils, sofern diese weiterhin dem Programm des CV folgten. Der Soziologe Kurt Sontheimer rezensierte es für die FAZ und drückte seine Hoffnung aus, es könne zur Neubelebung der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus beitragen. 6Das hat es wohl auch getan, allerdings eher indirekt und nicht auf die Art und Weise, die Eva Reichmann selbst intendierte. Die öffentliche Auseinandersetzung in der Bundesrepublik wurde in den sechziger Jahren von Gerichtsverfahren und der Berichterstattung dazu mehr beeinflusst als von wissenschaftlichen Büchern und Debatten. Die 68er-Studierendenbewegung befasst sich eher mit Adorno als mit Reichmann. Die öffentliche Debatte änderte sich dann bekanntlich erst mit der Fernsehserie „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss“, die 1979 ausgestrahlt wurde, und den Historikerdebatten in den 1980er Jahren. Bis dahin waren Eva Reichmann und ihr Buch vor allem in den Kontexten von Akademien, christlich-jüdischen Vereinen und den Einrichtungen zur politischen Bildung bekannt. In den sechziger und siebziger Jahren wurde ihr Buch in Seminaren zum Antisemitismus und zur jüdischen Geschichte gelesen und fand auf diese Weise Eingang in sozial und politisch distinkte Diskussionsgruppen. Es ist auf diese Weise vielen Menschen bekannt geworden und sicherlich als ein Klassiker einzuordnen, wenn auch eher als ein heimlicher Klassiker.
Wer heute nach zentralen Werken zur Analyse des Aufstiegs des Nationalsozialismus fragt, wird nicht den Namen von Eva Reichmann hören – und doch lohnt es sich nach wie vor, das Buch zu lesen, gerade auch vor dem Hintergrund aktueller Debatten über populistische Bewegungen, dem Erstarken des Rechtsextremismus in ganz Europa und der polarisierten Diskussion über den Umgang mit Minderheiten. Am Beispiel der „Judenfrage“ zeigt das Buch, was passieren kann, wenn soziale und wirtschaftliche Krisen von Populist*innen genutzt werden, um antirationale, antiliberale und antidemokratische Politik zu legitimieren – und eine große Zahl Menschen bereit ist, ihnen zu folgen. Sicher, Geschichte wiederholt sich nicht, doch die aktuellen gesellschaftlichen Spaltungen und individuellen Krisenerfahrungen gleichen doch in mancher Hinsicht den unruhigen zwanziger Jahren in Deutschland. Kein Zufall also, dass wieder verstärkt über Gruppenspannungen, emotionalisierte Politik und die Funktionalisierung von Ressentiments gegen Minderheiten in der politischen Debatte diskutiert und geforscht wird. 7Eva Reichmanns Buch hat damit eine neue Aktualität gewonnen – leider, so muss man sagen.
Читать дальше