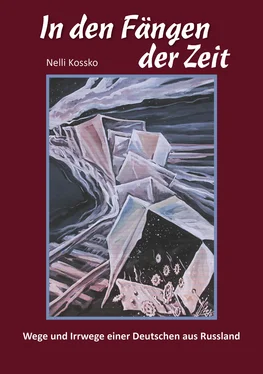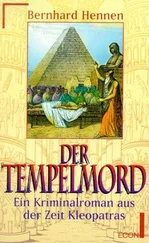So war unser Festschmaus traurig ausgegangen, und ich war schuld daran. Doch es gab eine Möglichkeit, einiges wiedergutzumachen. Ich sollte noch einige Birken- und Espenzweige für unsere Ziege holen, meinte Mama. Hatte ich richtig gehört? Zweige? Soweit ich wusste, fraß das Vieh schon immer Gras und im Winter Heu. Mir kamen starke Zweifel, doch ich tat wie befohlen und staunte nicht schlecht, als Musja nicht nur die kleinen jungen Blätter vernaschte, sondern auch genüsslich an den Zweigen knabberte! Während ich der Ziege zusah, ertappte ich mich plötzlich dabei, dass ich Musja beneidete. Ein Tier müsste man sein, dann wäre das Leben ganz einfach und leicht! Tiere schienen doch wichtiger als Menschen zu sein, Tiere ließ man nicht verhungern. Ob Musja einverstanden wäre, mit mir zu tauschen? Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen gehabt.
„In einer Woche haben wir Ferien“, frohlockte Lore, „da können wir uns den ganzen Tag im Wald herumtreiben. Es soll hier im Sommer viele Beeren und Pilze geben, sagen die Leute.“
„Zeugnisse wird es auch geben“, gab ich zu bedenken. Meine Gedanken gingen in eine ganz andere Richtung, denn in der Schule waren wir alle nicht besonders gut. Sprachschwierigkeiten, ewige Ängste und der Hunger förderten nicht gerade unsere geistigen Leistungen.
Meine Befürchtungen trafen zu. Außer in dem Fach Schönschreiben hatte ich überall nur ‚ausreichend’. Und obschon ich das vorausgesehen hatte, litt ich sehr darunter, denn ich lernte eigentlich gern und gut. Mama aber tröstete mich:
„Das ist ja glänzend in unserem Fall! Und jetzt sieh zu, dass du dich in den Ferien gut erholst. Obwohl“, sie sah mich traurig an, „obwohl ich mir nicht so sicher bin, dass du überhaupt dazu kommen wirst. Wir müssen für den nächsten Winter gut vorsorgen, wenn wir überleben wollen.“
Wir Kinder waren in dieser Zeit die eigentlichen Ernährer der Familie, besonders im Sommer, wenn es genug Brennnesseln, Pilze und Beeren im Wald und Fische im Fluss gab. Aber im Winter? Da konnten wir von Glück sagen, wenn wir etwas Essbares auftreiben konnten .
Wir waren verwahrloste, kleine, altkluge Greise, die hart zupacken mussten, sei es beim Mähen, Graben, Säen, Dreschen, Melken oder Pferdeversorgen. In der Zeit, die uns blieb, waren wir stets auf der Suche nach etwas Essbarem. Alle unsere Wünsche, Gefühle, Träume, all unser Denken, Sinnen und Trachten galten dem Essen. Wir hatten nicht einmal Lust zum Spielen. Nur manchmal wurden wir wieder wir selbst. Irgendwann hatte jemand ein Spiel erfunden, das etwa so hieß: „Was würdest du machen, wenn du ganz plötzlich einen Laib Brot fändest?“ Mit glänzenden Augen schrien wir wild durcheinander, unserer Phantasie waren keine Grenzen gesetzt .
Doch jedes Mal ging das Spiel traurig aus, denn am Ende waren wir wieder kleine, schutzlose, hungrige Kinder .
Doch schlimmer noch als die Kälte und der Hunger war unser Status als Feinde, Verschmähte, Ausgestoßene und Geächtete. Dass das Wort „Deutsche“ wie ein Peitschenhieb, wie eine unerträgliche Folter klingen kann, wird nur ein Betroffener nachempfinden können .
Aber es gab noch Steigerungsmöglichkeiten: Fritzen, Faschisten, deutsche Schweine, Nazis – und Worte, die unübersetzbar sind. Diese Beschimpfungen, dazu die Art, wie sie uns ins Gesicht geschleudert wurden, mit Abscheu, Verachtung, Ekel und Hass, waren eine zu schwere Bürde für unsere schmächtigen Schultern, und sicher waren wir oft nahe daran, aufzugeben und uns zu verleugnen .
Da hatten wir jedoch unsere Mütter gegen uns! Obwohl sie weder Zeit noch Kraft hatten, legten sie eine erstaunliche Ausdauer und Beharrlichkeit an den Tag, wenn es darum ging, Deutsch mit uns zu sprechen, Gebete und Gebote zu lehren, deutsche, vorwiegend kirchliche Lieder zu singen und uns wie „deitsche Mädle un Buwa“ zu erziehen, sehr oft gegen unseren hartnäckigen Widerstand. Aber gerade das erklärt, warum die meisten von uns nicht den Weg der Anpassung und Selbstverleugnung gegangen sind, sondern trotz allem zu ihrer Herkunft standen …
Nach den vielen Schicksalsschlägen wurden uns auch einige freudige Ereignisse zuteil.
Eines Abends kam Babuschka Ewdokija zu uns, ein altes Mütterchen, das eigentlich von allen nur „Liebste“ genannt wurde. Diesen Spitznamen verdankte sie zum Teil ihrer über alles gehenden Güte, zum Teil aber der Tatsache, dass sie ausnahmslos alle mit „Liebste“ beziehungsweise „Liebster“ ansprach.
„Liebste“, begann sie auch diesmal das Gespräch, nachdem sie sich vor den Heiligenbildern bekreuzigt und ihr Gebet geflüstert hatte, „die Sache ist die, Liebste,“ sie kam nicht weiter, weil ich losprusten musste. Auch die „Liebste“ lächelte, und unzählige winzige Fältchen zogen sich um ihre Augen zusammen, die alle Gutmütigkeit der Welt ausstrahlten. Sie wusste über ihren Spitznamen Bescheid und war nicht böse. Scherzhaft drohte sie mir mit dem krummen, von jahrelanger schwerer Arbeit verunstalteten Zeigefinger.
„Weißt du, Liebste“, wandte sie sich erneut an Mama und sah mich dabei warnend an, „ich bin alt geworden und zu nichts mehr gut, nicht mal meine Kuh kann ich mehr melken.“
Babuschka Ewdokija streckte ihre krummen, sehnigen Finger vor.
„Ich dachte mir, ich fahre zu meinem Sohn in die Stadt, da wird es wenigstens jemanden geben, der nach mir sehen könnte in den letzten Tagen, die ich noch zu leben habe. Allein ist es so einsam.“
Sie hielt inne und schwieg einen Augenblick. Wir konnten noch immer nicht verstehen, worauf die „Liebste“ eigentlich hinauswollte. Sie aber fuhr bedächtig fort:
„Mein Häuschen hier möchte ich aber nicht verkommen lassen.“ Sie war jetzt ganz traurig und flüsterte nur noch:
„Wenn die Fenster mit Brettern zugenagelt werden, dann ist es wie Nägel in meinen eigenen Sarg. Da dachte ich, dass vielleicht du mit der frechen Göre da“, sie drohte mir wieder mit dem Finger, „dass ihr in mein Häuschen …“
Wir begannen zu verstehen, wagten aber nicht, an so viel Glück auf einmal zu glauben.
„Ich dachte also, du könntest auf mein Häuschen aufpassen, solange ich weg bin, und es wäre für uns beide gut.“ Fragend sah die „Liebste“ Mama an. Mama rührte sich nicht und sagte auch nichts. Babuschka Ewdokija war nahe daran, ihr Schweigen falsch zu verstehen, da fiel ich ihr schon um den Hals und küsste das welke, runzlige kleine Gesichtchen ab.
Es ging alles sehr schnell. Babuschka Ewdokija verkaufte Kuh und Schafe und packte dann ihre Siebensachen. Auf ein großes Tuch legte sie ihre Wäsche zum Wechseln und die Winterkleidung, schnürte alles zu einem Bündel zusammen, verstaute in dem anderen Bündel Kissen und Decken, und zog ihre Sonntagskleider an.
Bald kam der Pferdeknecht Onkel Mitja, der die „Liebste“ die fünfzig Kilometer bis zur Bahn fahren sollte. Babuschka Ewdokija sagte leise:
„Setzen wir uns vor der Reise kurz hin.“
Wir setzten uns und blieben ein Weilchen sitzen, wie es bei diesem alten russischen Brauch üblich ist. Danach stand die „Liebste“ auf, schlug vor den Heiligenbildern das Kreuz, sah sich in der Stube um, als wollte sie sich alles fest einprägen, und ging schnell hinaus, wo Onkel Mitja schon ungeduldig wartete. Wir winkten noch lange dem Wagen nach, bis die zusammengeschrumpfte Gestalt der gütigen Greisin nicht mehr zu sehen war. Dann gingen wir in unser neues Heim.
Eine Zeit härtester Arbeit begann. Wir durften Babuschka Ewdokijas Gemüse- und Kartoffelgarten unter der Bedingung benutzen, dass dafür hundert Tagewerke in der Kolchose abgeleistet wurden. Es wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn Mama wenigstens an den Ruhetagen zu Hause hätte sein können, aber mit dem einen freien Tag im Monat, der genehmigt worden war, konnte sie nicht viel anfangen. Also musste ich zusehen, dass ich allein mit der Arbeit fertig wurde.
Читать дальше