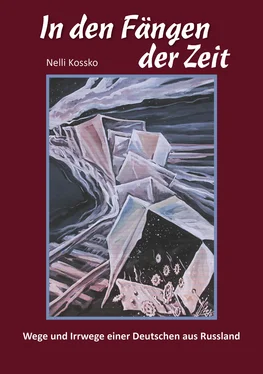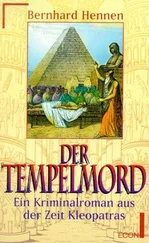Menschen starben wie die Fliegen. Unser Friedhof wurde immer größer, viel größer als das Dorf selbst. Wir schwänzten oft die Schule, weil wir den weiten Weg nach Dorofejewo nicht mehr schafften, und weder die Schule noch unsere Mütter nahmen uns das übel.
Wir saßen dann meist träge auf dem Erdaufwurf vor einem Bauernhaus in der warmen Frühlingssonne und schwiegen. Nur dann und wann fiel eine Bemerkung, die meist vom Essen handelte, bis dann jemand wütend „Klappe!“ schrie und wir uns verzankt in die Häuser und Baracken verkrochen.
Not macht erfinderisch. Sobald die ersten Brennnesseln zum Vorschein kamen, wurden in allen deutschen Familien Brennnesselsuppen, Brennnesselspinat, sogar Brennnesselpudding gekocht und Brennnesselfladen und Brennnesselbrot gebacken.
Schon sehr früh am Morgen gingen wir Kinder auf die „Jagd“, denn es gab mehr Anwärter auf etwas Essbares als Brennnesseln. Doch dann entdeckten wir an den Waldwegen ganze Brennnesselstauden. Gewappnet mit Persenningfäustlingen und Körben gingen wir in den Wald, wo es jetzt auch etwas zum Naschen gab: zarte, süßliche Stangen von Rentiermoos, die man geschält essen konnte, leckeren Sauerklee und, wenn wir Glück hatten, auch Sauerampfer. Vollgestopft mit diesem Grasfutter, stellten wir zu Hause unsere Körbe ab und liefen in die Schule. Sonderbar, aber der Magen vertrug diese Kost. Nur wenn wir zu viele „Kerzen“ von den jungen Fichten verdrückten, bekamen wir arge Bauchschmerzen. An einem solchen Frühlingstag kam Mama ganz aufgeräumt nach Hause:
„Wir bekommen jeden Monat einen Sonntag frei, damit wir auch zu Hause was machen können“, Mamas Augen glänzten, „und vielleicht wird uns die Kolchose ein Stückchen Land geben, wo wir Kartoffeln und Gemüse pflanzen können.“
Ich musste staunen:
„Wieso auch nicht? Wo doch ringsum soviel Land ist, das keinem gehört?“
„Das scheint nur so, das ganze Land hier gehört der Kolchose“, Mama hatte ihre liebe Not mit mir. „Nur sie hat darüber zu bestimmen, egal, ob das Land nun von der Kolchose bebaut wird oder brach liegen bleibt. Da ist eben nichts zu ändern“, fügte sie schon gereizt hinzu. Gott sei Dank sagte sie nicht wieder, ich würde ihr Löcher in den Bauch fragen. Ich hätte schon gern gewusst, warum die Kolchose ihr Land lieber unbestellt liegen lässt, als es uns zu geben. Aber ich hatte mich daran gewöhnt, dass die Erwachsenen auf jede Frage eine Antwort parat hatten, die oft nicht sehr einleuchtend war. Deshalb ließ ich die Fragerei.
„Morgen gehe ich nach Semjonowskoje.“ Erschrocken sah ich zu Mama hoch:
„Musst du wieder zum NKWD?“
„Nein, ich gehe auf den Markt.“
Hatte ich richtig gehört? Hatte sie „auf den Markt“ gesagt? Gibt es denn noch so was? Und womit will sie da einkaufen, falls überhaupt?
In meiner Verwirrung merkte ich nicht, dass ich all diese Gedanken nur gedacht, nicht aber ausgesprochen hatte. Mama holte ihre Kassette, die vereinsamt in unserem mittlerweile fast leeren Koffer lag, und entnahm ihr die dort aufbewahrten Schätze: eine goldene Uhr an einem dünnen Kettchen, zwei goldene Ringe mit funkelnden Steinen und eine Brosche. „So, damit gehe ich morgen einkaufen.“
Sie packte alles in ein Taschentuch und zog es mit einem Knoten zu.
„Aber Mama“, wandte ich entsetzt ein, „du sagtest doch, das alles habe dir Papa geschenkt?“
„Das stimmt auch, mein Kind!“ Mamas Gesicht, noch vor einigen Sekunden lebhaft und fast fröhlich, wirkte müde und abgespannt. „Es hat sowieso keinen Sinn mehr. Außerdem habe ich noch etwas von Papa, das mir niemand auf der Welt wegnehmen kann. Wir haben uns beim Abschied versprochen, jeden Abend zum Mond zu schauen und aneinander zu denken. Der Mond ist unser Vermittler.“ Dann sagte sie kein Wort mehr. Ich sah zum Fenster hinaus. Vielleicht sendete mein Papa gerade in diesem Augenblick Grüße an Mama und mich, an seine, wer weiß, wo in der Welt verstreute Familie. Vielleicht.
Als Mama gegen Abend aus Semjonowskoje zurückkam, traute ich meinen Augen nicht: Sie trug schwer an einem Sack, der mehr als bis zur Hälfte gefüllt war, und führte an der Leine eine echte weiße Ziege! Musja, diese Ziege, gehörte, wie es sich sofort herausstellte, uns! Sie war wunderschön, ganz weiß, mit langen, gewundenen und weit auseinanderstehenden, an den Enden nach unten gebogenen Hörnern, einem kurzen Schwanz und prallem Euter! Nur eines störte mich, nämlich der lange Bart. Schließlich war es doch eine Ziege und kein Ziegenbock! Mama lachte und sagte, ich solle unsere Zinnkanne holen. Außer Atem kam ich zurückgelaufen und sah zu, wie Mama sich auf den Melkschemel setzte und kräftig an den Zitzen der Ziege zu ziehen begann. Ich wurde unruhig. Ob das Musja nicht weh tat?
Doch dann hörte ich den feinen Klang der Milchstrahlen in der Kanne – ding-dong, ding-dong in regelmäßigem Takt und dann immer schneller und schneller. Musja stand still, offensichtlich machte es ihr sogar Spaß, gemolken zu werden. Ich war erleichtert und konnte es nicht erwarten, von der Milch, unserer eigenen Milch zu kosten. Musja war großzügig, gleich einen ganzen Liter Milch hatte sie uns abgegeben!
Doch Mama schien es nicht eilig zu haben. Sie seihte die Milch durch, goss dann langsam zwei Tassen voll, während ich mir die Hand vor den Mund halten und kräftig schlucken musste, damit mir der Speichel nicht über das Kinn lief. Dann ging Mama zum Sack, den sie mitgebracht hatte, bückte sich und kramte darin herum. Als sie sich aufrichtete, begann sich alles um mich herum zu drehen: Wie eine Märchenfee stand Mama in der Mitte unserer Stube und hielt ein Brot in den Händen, einen ganzen Laib Brot! Durch meine hungrigen Tränen starrte ich ungläubig auf dieses Wunder, dann auf Mama, die unsicher lächelte, als ob sie sagen wollte:
„Ich kann’s ja auch nicht glauben, aber es scheint wahr zu sein!“
Endlich gelang es mir, einigermaßen klar zu denken. Ich stand auf und ging unsicher auf das Brot zu, betastete es, roch daran, sah dann wieder zu Mama hoch, nein, es war keine Attrappe, es war richtiges Brot, schwarzes Brot mit Kruste, von dessen Geruch allein man schon verrückt werden konnte!
Mama setzte das Messer an, zögerte einen Augenblick, schnitt dann ganz schnell zwei fingerdicke Scheiben ab und legte den Rest in den Spind.
Ich konnte mich nicht länger beherrschen, griff, noch bevor sich Mama an den Tisch setzte, nach Milch und Brot, biss hastig in die schwarze klebrige Masse. Mama, die solche Unartigkeiten auch in der Hungerzeit nicht duldete, sah mich vorwurfsvoll an:
„Du musst jetzt langsam essen, mein Kind, lange, lange kauen musst du, dann wirst du auch einigermaßen satt!“
Doch gerade das war zu viel verlangt, ich hätte ihren Rat um keinen Preis befolgen können, auch wenn man mich auf der Stelle für meine Unsitte erschlagen hätte! So schlang ich blitzschnell alles hinunter. Mama wiegte nur traurig den Kopf, seufzte und schob mir dann den Rest ihres Anteils zu. Ich hatte noch so schlimmen Hunger! Das bisschen Milch und Brot waren wie ein Tropfen Wasser auf den heißen Stein.
„Aber Mama hat doch auch noch Hunger“, versuchte ich das hungrige Tier in mir zu besänftigen, während meine Hand wie von selbst blitzschnell nach der Tasse und dem Brot griff! Ich verschlang alles gierig und konnte vor lauter Scham den Blick nicht heben. Dann hörte ich Mama weinen.
Sie drückte mich an sich, mich, das Ekel, das ihr eben das Stückchen Brot weggegessen hatte, und hörte nicht auf zu weinen.
„Mein Gott, Kleines, was würde ich nicht alles tun, damit wenigstens du nicht zu hungern brauchtest!“ Sie hob die zum Gebet gefalteten Hände empor, und Tränen überströmten ihr Gesicht:
„Heiliger Jesus Christus, unser Retter und Erlöser!“, flüsterte sie inständig unter Tränen, das Gesicht gegen die Decke gewandt, „warum hast du uns so hart bestraft? Was haben wir verschuldet, o Herr, dass wir so schwer an unserem Kreuz tragen müssen? Bitte, o Herr, lass endlich Gnade walten, nicht für uns bitten wir, sondern für unsere Kinder, die doch nichts haben verschulden können!“
Читать дальше