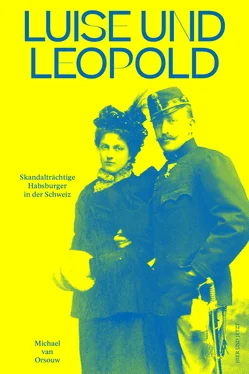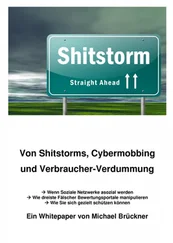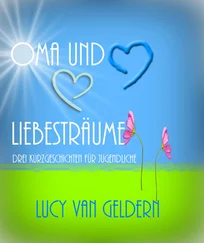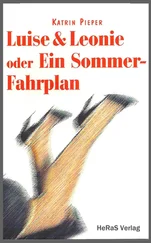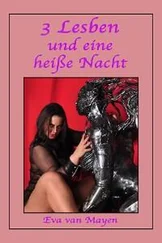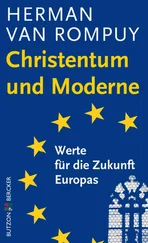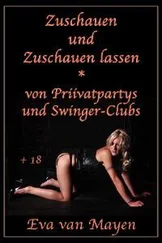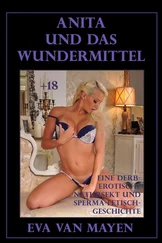Seine Intoleranz stellt König Georg von Sachsen unter Beweis, als er sich weiterhin daran ergötzt, sich an der gefallenen Schwiegertochter zu rächen. Am 13. Januar 1903 verfügt er ganz offiziell den Ausschluss Luises aus dem sächsischen Königshaus. Sie darf sich fortan nicht mehr Kronprinzessin von Sachsen nennen. Sie ist also auf ihren Titel zurückgeworfen, den sie seit ihrer Geburt trägt: Erzherzogin von Österreich-Toskana.
Auch Kaiser Franz Joseph ist seit dem gescheiterten Vermittlungsversuch im Dezember mehr als nur verärgert; er will unter allen Umständen verhindern, dass seine Skandalverwandte wieder vermehrt mit dem Kaiserhaus in Verbindung gebracht wird. Er weist seinen Aussenminister, Agenor Graf Goluchowski, an, Luise das Führen von Habsburger Ehrentiteln zu verbieten und sie per sofort aus dem genealogischen Verzeichnis der Kaiserdynastie zu streichen; dieser Graf, des Kaisers Mann fürs Grobe, hatte zuvor schon Leopold eine schroffe Abfuhr erteilt.
Franz Josephs Wut auf Luise muss wirklich gross sein, denn ihr Ausschluss aus dem Hause Habsburg ist der erste in der jahrhundertelangen Geschichte. Noch nie wurde ein Mitglied des österreichischen Kaiserhauses einseitig ausgeschlossen. Die Wiener Montags-Post nennt es «die schärfste Strafe», die der Kaiser verhängen könne. Der Graf überbringt die schlechte Nachricht. Luise verliert damit ihren Familiennamen. Und alle ihre Titel. Sie ist keine Kronprinzessin von Sachsen mehr. Und auch keine Erzherzogin von Österreich.
Sie hat ihren Mädchennamen eingebüsst.
Und den Familiennamen.
Sie heisst einfach nur noch «Luise».
Die Zürcherische Freitagszeitung bringt es auf den Punkt: «Sie ist nichts mehr, nichts als ein armes, flüchtiges Weib.»
Nach diesem Rummel und der folgenreichen Abnabelung lechzt Luise nach einer Veränderung. Sie entscheidet sich, mit ihrem Geliebten André Giron die Stadt Genf heimlich zu verlassen. Luise und Giron packen am Samstag, den 18. Januar, ihre Koffer, die ein Genfer Camionneur im Morgengrauen abholt und der gleichzeitig die Fahrkarten für die Eisenbahn besorgt hat. Denn Luise und André wollen ohne Aufsehen nach Menton reisen, in diesen Kurort an der Côte d’Azur, der wie Montreux zu dieser Zeit bei der Hautevolee ganz Europas besonders beliebt ist. Sie flüchten, wie Zeitungen zu Recht titeln, bereits das zweite Mal in fünf Wochen.
Um unbemerkt den Reportern zu entkommen, verlassen Luise und Giron das Hotel d’Angleterre am Morgen um 6.55 Uhr durch eine Hintertür, nachdem sie mehr als einen Monat dort gewohnt haben. Zuvor hat Luise dem Hoteldirektor August Reichert zum Abschied eine prachtvolle Krawattennadel geschenkt, besetzt mit Perlen und Diamanten; der Maître d’Hôtel hat einen prächtigen Goldstift erhalten und das Personal grosszügiges Trinkgeld.
Auf Umwegen gehen Luise und ihr Geliebter zu Fuss zum Bahnhof und besteigen dort die Eisenbahn, die um 7.40 Uhr in Richtung Lyon losdampft. Damit sensationslüsterne Leute nichts mitkriegen, ziehen die beiden Reisenden sofort die Vorhänge ihres Coupéfensters.
Doch die Mühe ist vergebens, denn auf den Zugperrons in Genf, Lyon, Marseille und schliesslich in Menton stehen die Reporter bereits bereit, um die letzten Neuigkeiten über das Skandalpaar aufzuschnappen. Etwas enttäuscht kann der Reporter aus Lyon lediglich berichten, dass der Zug pünktlich um zehn Uhr eingetroffen sei: «Einige Agenten der Lyoner Sicherheitspolizei überwachten den Bahnhof. Das Publikum wurde indessen durch nichts aufmerksam auf die Persönlichkeiten der Reisenden gemacht.»
Das illustre Paar bleibt im Schlafwagen, den die Bahnleute in Lyon und Marseille umkoppeln. Am nächsten Morgen, um elf Uhr, treffen Luise und André in Menton ein und beziehen ein Zimmer im Hotel des Anglais. Mitgekommen ist auch die 26-jährige Luise Meyer, ein Kammermädchen aus dem Kanton Bern, das zuvor im Hotel d’Angleterre gearbeitet hat. Luise und Giron wollen bis Ende Februar bleiben.
Die welsche Zeitung La Liberté spricht von Luise und ihrem Geliebten als «Faulenzern»: «Wir können uns nur gratulieren, dass unser Land nicht mehr Schauplatz ihres Skandals ist.» Ins gleiche Horn stösst die Gazette du Valais: «Die Anwesenheit dieses vorgegebenen Paars mit ihren zahllosen Interviews war ein fortwährender Skandal. Der Bundesrat und die Genfer Regierung können aufatmen.»
Auch in Menton stellen die Fotografen dem illustren Paar nach und verbreiten die Bilder in Windeseile; weil die damaligen Kameras noch keine Paparazzibilder liefern können, kommen die Illustratoren zum Zug, welche Luise und Giron zum Beispiel in der Kutsche zeichnen. Die Zeitungskommentatoren staunen, dass die beiden ausgerechnet in Menton abgestiegen sind – nämlich dort, wo jeweils auch König Georg von Sachsen, der Widersacher Luises, sich aufzuhalten pflege und bereits erwartet werde. Doch der Aufenthalt an der Côte d’Azur hält noch ganz anderes bereit.

Auf Schritt und Tritt von Reportern verfolgt: Luise mit Giron in Menton.
Eine Überraschung folgt der nächsten
Die Zeit in Menton entwickelt sich nämlich für die erholungsbedürftigen Luise und Giron ganz anders als erwartet. An jeder Strassenecke lauert ein Reporter, der kompromittierende Situationen in Text und Bild einfangen will. Die Zeitungsleute berichten, wie und wann sie auf dem Quai spazieren, wo sie dinieren, wie lange sie Kutsche fahren und wen sie treffen. Aber auf einem Foto, das die beiden auf der Strasse in Menton zeigt, wirken sie wie ein gewöhnliches Ehepaar.
Beide mit Hut.
Und in dunklen Kleidern.
Sie mit dem Schirm in der Rechten.
Er mit dem Spazierstock in der Linken.
Sie halten Hand. Wie zwei Frischverliebte – und als ob sie gegenüber dem Fotografen ihre Liebe zelebrieren wollten.
Wildfremde Leute erkennen das prominente Liebespaar auf der Strasse, rempeln oder pöbeln es an. Von solchen Erlebnissen schockiert, verbunkern sich Luise und ihr Galan für zwei Tage im Hotel. Einem Reporter sagt Giron: «Wir werden nach einem anderen Ort suchen und nach Amerika reisen, sobald die Scheidung abgeschlossen ist.»
Daraufhin machen die beiden einen Ausflug nach Sanremo: Sie sehen sich die Stadt an und besuchen die Villa de Murisier, die sie mieten wollen. Doch der Prinzessin wird es plötzlich unbehaglich – es sei daran erinnert, dass sie immerhin im fünften Monat schwanger ist.
Auch ein weiterer Trip fällt nicht aus wie erhofft. Giron überredet Luise zu einem Ausflug nach Monaco, ins Spielcasino von Monte Carlo. Sie ziehen von Roulettetisch zu Roulettetisch, und Giron setzt jedes Mal einen Louisdor auf die Nummer 31; er verliert, gewinnt, verliert. Luise als seine aufsehenerregende Begleiterin trägt eine schicke Robe aus hellblauer Seide, ein pelzgefüttertes Cape und dazu einen blauen Federhut. So erkennen andere Casinobesucherinnen und -besucher das illustre Paar sofort, das daraufhin wenig schmeichelhafte Bemerkungen über sich ergehen lassen muss.
Damit nicht genug: Luise und ihr Begleiter geraten ins Fadenkreuz der örtlichen Polizei, die auftaucht und sie bittet, sich auszuweisen. Das ist der Kronprinzessin in ihren 32 Lebensjahren noch nie widerfahren: dass sie sich wie eine dahergelaufene Bürgerin ausweisen muss! Hinzu kommt, dass sie gar keine Ausweispapiere hat. Deshalb wird verfügt, dass sie den Spielsaal sofort zu verlassen habe. Immerhin weist ihr die Polizei den Weg durch eine Nebentüre, damit das Aufsehen nicht zu gross ist. Lokale Amtspersonen setzen die einstige Kronprinzessin vor die Türe eines öffentlichen Lokals – ein neuer Eklat ist perfekt, den die Zeitungen wieder genüsslich breittreten.
Читать дальше