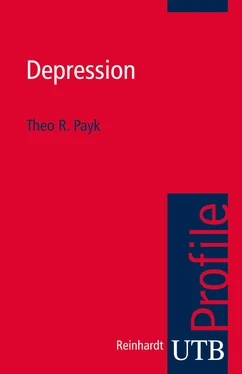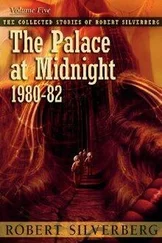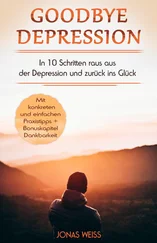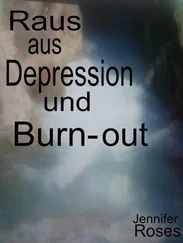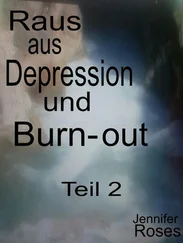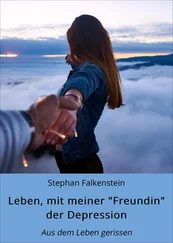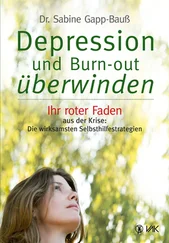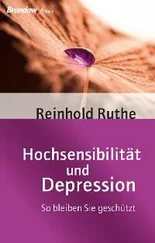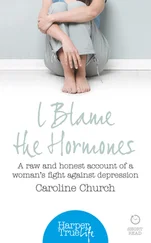Große Beachtung fand seinerzeit die aufwendige „psychische Kur“ des Berliner Medizinprofesssors Johann Christian Reil (1759–1813) zur Behandlung geistiger und seelischer Störungen. Sie beruhte auf der Hypothese einer umstimmenden bzw. erzieherischen Wirkung nach dem Lohn-Strafe-Prinzip – erste methodische Umsetzungen einer drastisch aversiven Verhaltenstherapie. So wurden in den Irrenhäusern bei Melancholie als angenehme Stimulanzien etwa der Genuss von Wein oder Mohnsaft, Wärme, Streicheln, Gymnastik, Theaterspielen, Musizieren, Singen und Tanzen, heitere Erzählungen und zerstreuende Lektüre, leichtere Geistesarbeit und gärtnerische Betätigung vermittelt. Als schmerzhafte Sanktionen wurden demgegenüber bei unerwünschtem Verhalten z.B. Isolation, Nahrungsentzug, kalte Bäder, Rutenschläge oder Peitschen mit Brennesseln eingesetzt. Etwa zeitgleich kurierte in sehr gefragten Suggestivsitzungen der Modearzt Franz Anton Mesmer (1734–1815) in Wien und Paris u. a. Nervenschwäche und nervöse Erschöpfungszustände mit den vermeintlich heilenden Kräften des „animalischen Magnetismus“.
Charles Darwin (1809–1882), Begründer der modernen Evolutionslehre, legte die Grundlagen systematischer Untersuchungen zur Ausdruckskunde. Auch für die Geistes- und Gemütskranken wurden vermeintlich 15typische Merkmale der Physiognomie als Erkennungszeichen gesammelt und bildnerisch festgehalten, ab dem 19. Jahrhundert unterstützt und erweitert durch fotografische Dokumentationen. Außerdem widmete man sich der näheren Erforschung des Nervensystems. Obgleich – wie gesagt – bereits in der Antike das Gehirn als Sitz der Seele angesehen wurde, dauerte es mehr als 2000 Jahre, bis Mutmaßungen über die Beziehungen zwischen seelischen Funktionen und bestimmten Hirnregionen durch exakte wissenschaftliche Beobachtungen belegt werden konnten.
An den gewaltigen Fortschritten in den Naturwissenschaften der Neuzeit hatten Chemie und Medizin großen Anteil. So etablierte sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Lehre von der Erkennung und Behandlung psychischer Krankheiten als eigenständige Wissenschaft. Damals wurden die Vorraussetzungen der bis heute gängigen Richtlinien zu deren Diagnostik und – inzwischen mehr oder weniger modifizierten – Einteilung und Zuordnung geschaffen. Auch die Melancholie wurde nun grundsätzlich als Erkrankung des Nervensystems betrachtet.
Mit der Entdeckung und industriellen Herstellung der ersten künstlichen Beruhigungs- und Schlafmittel Chloralhydrat (1869) und Barbiturat (1903), die noch heute in Gebrauch sind, begann die Ära der modernen, synthetischen Psychopharmaka. Nachdem in den 1950er Jahren mit dem Chlorpromazin das erste Pharmakon zur Behandlung psychotischer Symptome in die Psychiatrie eingeführt worden war, wurde es auch gegen Depressionen ausprobiert. Es erwies sich jedoch als wirkungslos, so dass nach anderen chemischen Wirkstoffen gesucht wurde, bis mit Imipramin 1956 das erste neuzeitliche Antidepressivum gefunden und zwei Jahre später in den Handel gebracht wurde. Von da an gab es einen weltweiten Siegeszug dieser Medikamentengruppe, bis auf den heutigen Tag gefolgt von weiteren Spielarten und Nachfolgegenerationen, die regulierend auf das vermutete Ungleichgewicht von Botenstoffen im Nervensystem Einfluss nehmen. Schrittweise wurden diese Substanzen verbessert, so dass heute eine breite Palette an antidepressiven wirksamen Mitteln zur Verfügung steht.
Erfahrungen aus der Psychoanalyse und die empirischen Erkenntnisse der Lernpsychologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lieferten die Grundlagen zu zwei neuen, wirksamen Methoden der psychologischen Beeinflussung seelischer Störungen: tiefenpsychologische bzw. „aufdeckende“ Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Beide Richtungen wurden in der Folgezeit ebenfalls hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Ökonomie überprüft und fortentwickelt. Zweifelsohne 16wird der Trend zu sowohl gezielter als auch verträglicher wirkenden Therapien – wie in anderen Bereichen der Heilkunde – sich fortsetzen und noch bessere Behandlungsinstrumente zur Verfügung stellen. Schwieriger wird es hingegen sein, auf die Lebensumstände und sozioökonomischen Verhältnisse einzuwirken, die einer Entstehung depressiver Zustände Vorschub leisten.
Angesichts des beschriebenen, starken Anstiegs depressiver Erkrankungen in den hochindustrialisierten westlichen Ländern, die zudem meist mit längeren Krankschreibungen einhergehen, wurde auf einer WHO-Konferenz 2005 in Helsinki ein europäischer Aktionsplan für psychische Gesundheit beschlossen. Im Jahr 2006 wurde auf Veranlassung der Gesundheitsministerkonferenz – nach den ersten fünf nationalen Gesundheitszielen unter den Stichwörtern Diabetes, Brustkrebs, Nikotinkonsum, Patientensouveränität und Frühprävention – als 6. Ziel das Erkennen und Behandeln von Depressionen deklariert.
Obiger WHO-Plan beinhaltet im Übrigen auch Maßnahmen zur Verhinderung von Suizidrisiken, von denen im Folgenden noch die Rede sein wird. In Deutschland wurden bereits 2001 erste Schritte zu einem „Bündnis gegen Depression“ unternommen, das inzwischen zahlreiche regionale Aktivitäten professioneller und interessierter Mitarbeiter zusammenfasst.
Merksatz
Etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts etablierten sich die wissenschaftlichen Grundlagen der neuzeitlichen neuropsychiatrischen und psychologisch-psychotherapeutischen Erkenntnisse zur Diagnostik und Therapie. Inzwischen haben sich daraus differenzierte Konzepte zur Behandlung psychischer Störungen entwickelt.
Literatur
Eckart, W. E., Jütte, R. (2007): Medizingeschichte. Böhlau, Köln / Weimar / Wien
Kuiper, P.C. (2007): Seelenfinsternis. 9. Aufl. Fischer, Frankfurt / Main
Payk, Th. R. (2000): Psychiater – Forscher im Labyrinth der Seele. Kohlhammer, Stuttgart
Hauptteil
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.