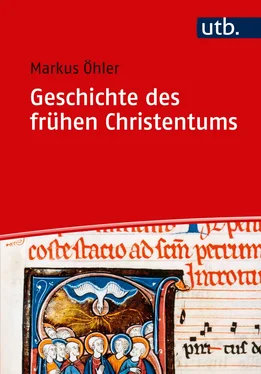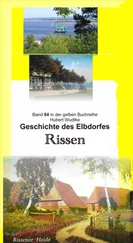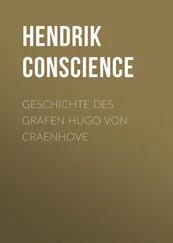Juden oder Judäer?
(Judaioi)
Anfang des 21. Jh. setzte in der Judaistik wie in der Erforschung des frühen Christentums eine Debatte ein, die gegenwärtig noch anhält und deren Ausgang noch nicht entschieden scheint. Dabei geht es um die Frage, ob die griechische Bezeichnung Ίουδαίοι/Judaioi mit „Juden“ oder mit „Judäer“ zu übersetzen ist.
Für die Wiedergabe mit „Judäer“ ist Folgendes vorgebracht worden: Es handelt sich aus antiker Perspektive eindeutig um ein Volk, nicht um eine Religion. Auch alle anderen griech. Volksbezeichnungen verweisen auf den Herkunftsort des entsprechenden Volkes. Ob Judaioi tatsächlich in Judäa selbst wohnen oder in der Diaspora, ist dabei irrelevant. Auch der griechische Begriff Ίουδαϊσμός/Judaismos ist dementsprechend nicht mit „Judentum“ wiederzugeben, also im Sinne einer Religion, sondern meint die Orientierung an der Lebenskultur des Volkes der Judäer. Die klassische Wiedergabe von Judaioi mit „Juden“ wird allerdings vehement verteidigt. Zum einen verstünden sich bereits seit der Makkabäerzeit die Judaioi selbst als Volk und Religion zugleich. Das zeige sich daran, dass man zum Judaismos übertreten kann (vgl. 2Makk 6,1–11 und 9,13–17). Zum anderen werde mit der Bezeichnung „Judäer“ die antike Geschichte des Judentums vom gegenwärtigen Judentum getrennt. „Judäer“ sollte daher ausschließlich für Bewohner des Gebietes Judäa in Palästina verwendet werden.
Im vorliegenden Buch werden beide Begriffe verwendet, wobei durch den Gebrauch jeweils angezeigt werden soll, ob eine vor allem ethnische oder eine kulturell-religiöse Perspektive vorliegt, auch wenn beides miteinander eng verbunden bleibt.
1. keine schon abgeschlossene Trennung vom Judentum impliziert ist;
2. keine soziologische oder theologische Einheit vorausgesetzt wird;
3. der Zusammenhang zwischen der Zeit des historischen Jesus und der Zeit der Gemeinschaften von Christusgläubigen nicht übergangen wird.
1.1.2 „Urchristentum“ oder „Frühes Christentum“?
(Die Fiktion der idealen Anfänge)
Der Begriff „Urchristentum“ stammt von Johann Bernhard Basedow (1723–1790) und ist eine abgekürzte Form von „ursprüngliches Christentum“. Er bezeichnet hier noch keine Zeitepoche, sondern das nach seiner Meinung unverfälschte, reine und originale Christentum, das in Verfall geraten sei. Diese Verfallstheorie beherrschte im 19. Jh. auch in anderen Bereichen der Wissenschaft den Blick auf die Anfänge kultureller und naturwissenschaftlicher Phänomene (u. a. Sprachwissenschaft, Anthropologie, Geologie). In der modernen Forschung wird der Begriff „Urchristentum“ allerdings nicht mehr ausdrücklich wertend, sondern im Blick auf einen Zeitabschnitt oder eine Epoche verwendet, wie z. B. zuletzt in dem Werk von Dietrich-Alex Koch. Der Ausdruck hat zwei Vorteile: 1) Es handelt sich um eine eingebürgerte Begrifflichkeit. 2) Eine Verwechslung mit dem Wissenschaftsbereich der frühchristlichen Archäologie bzw. Kunstgeschichte, die die Zeitspanne bis zum 6. Jh. n. Chr. untersucht, wird damit vermieden.
(Begriffsbildung)
Gegen die Verwendung von „Urchristentum“ spricht allerdings, dass damit vielfach immer noch eine Idealisierung der fernen Vergangenheit und eine Kritik an der Gegenwart verbunden werden. Das betrifft auch Ausdrücke wie „Urperiode“, „Urgemeinde“ oder „Urkirche“. Zudem finden sich in der Erforschung der griechisch-römischen Antike keinerlei Analogiebildungen, etwa im Sinne eines „Ur-Mithraismus“ oder eines „Ur-Judentums“. Auch die angloamerikanische Forschung hat diese Terminologie nicht aufgenommen. Alternativen haben sich zu Recht nicht durchgesetzt: Die Rede vom apostolischen bzw. nachapostolischen Zeitalter hat den Nachteil, ideale Anfänge, noch dazu verknüpft mit der schon im 1. Jh. n. Chr. umstrittenen Bezeichnung „Apostel“, zu konstruieren.
Man sollte daher einen neutralen Begriff verwenden: „Frühchristentum“, „Frühes Christentum“ oder „Anfänge des Christentums“ beschreiben dementsprechend das Phänomen, um das es im Folgenden gehen wird.
1.1.3 Die zeitliche Abgrenzung
(Beginn)
Die Frage, wann das Christentum beginnt, was also zu einer Geschichte des frühen Christentums gehört, wurde und wird unterschiedlich beantwortet. Zahlreiche Rekonstruktionen beginnen mit Jesus von Nazareth. Der Grundgedanke ist dabei, dass zwischen dem Wirken Jesu und der Entwicklung des Christentums eine Kontinuität besteht, die auch konzeptionell abgebildet werden soll.
(Jesus als Teil des frühen Christentums?)
Der Gegenentwurf sieht den Beginn des Christentums beim Tod Jesu bzw. bei der Ostererfahrung. Die theologische Begründung dafür geschieht häufig im Anschluss an Rudolf Bultmann, der die Bedeutung des Osterereignisses in den Vordergrund rückte. Erst ab der Zeit, als es einen wie auch immer gearteten „Glauben an Christus“ gegeben habe, könne man von Christentum und daher auch von seiner Geschichte sprechen. Jesus habe keine Bewegung oder gar „Religion“ gründen wollen, diese sei erst nach Ostern entstanden.
Beide Optionen haben ihre Nachteile: Ein Ansatz bei Jesus oder sogar bei Johannes dem Täufer steht in der Gefahr, die durch die Ostererfahrung bewirkten Unterschiede im Verständnis der Geschichte Jesu und der Entwicklung des frühen Christentums zu verwischen. Nach Ostern, das zeigen die Darstellungen der Evangelien, war Jesus von Nazareth für die ersten Christusgläubigen der geglaubte Christus, der als gegenwärtiger Herr seine Gemeinde leitet und über die Geschichte herrscht.
Ein Ansatz einer Geschichte des frühen Christentums erst nach Ostern ist in der Gefahr, die vor- und nachösterlichen Entwicklungen auseinanderzureißen und damit ein wesentliches Moment der Geschichte des frühen Christentums, die Kontinuität, zu vernachlässigen. Die Prägung des Christentums durch das Wirken des historischen Jesus tritt dabei stark in den Hintergrund.
Das vorliegende Lehrbuch setzt bei Jesus, genauerhin bei seiner Geburt, ein, schlicht aus dem pragmatischen Grund, dass eine Geschichte des frühen Christentums auch auf die Fragen nach den „vor-christlichen“ Anfängen Antworten geben muss. Dabei wird im Folgenden darauf geachtet werden, dass jene einschneidenden Veränderungen, die die Kreuzigung Jesu und die Auferstehungserfahrungen für die Anfänge des christlichen Glaubens und daher auch für dessen historische Re-Konstruktion bedeuten, nicht zugunsten der Betonung von Kontinuität verloren gehen.
(Ende)
Wann von dem Ende des frühen Christentums gesprochen werden kann, ist ebenfalls umstritten. Wann waren die Anfänge abgeschlossen und wann begann die Zeit der Alten Kirche?
(Konsolidierung / 4 v. Chr. bis 135 n. Chr.)
Es finden sich sehr frühe Abgrenzungen: der Tod des Paulus bzw. der Apostel in den späten 60er-Jahren des 1. Jh. n. Chr. oder das etwa zeitgleiche Ende des 1. Judäischen Aufstands mit der Zerstörung Jerusalems 70 n. Chr. Allerdings stammen die meisten Texte des Neuen Testaments aus den letzten Jahrzehnten des 1. und ersten Jahrzehnten des 2. Jh. n. Chr. Hinzu kommt, dass theologische und institutionelle Ansätze aus der Frühzeit in der ersten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. zwar nicht zu einem Abschluss kamen, aber Entwicklungen erreichten, hinter die man später nur noch selten zurückging. Das gilt etwa für die Ausformung von Gemeindestrukturen oder die Bedeutung autoritativer Schriften, die dann später Teil des neutestamentlichen Kanons wurden. Diese Konsolidierungsphase setzt mit den Schriften der sogenannten „Apostolischen Väter“ ein, u. a. der Didache, den Ignatiusbriefen und dem 1. Clemensbrief, und reicht bis zu den ersten apologetischen Texten wie dem Quadratus-Fragment, der Apologie des Aristides, dem Kerygma Petri und dem Diognetbrief. Letztere markieren durch die literarische Hinwendung an eine intellektuelle Elite eine Neuorientierung. Sie fällt zeitlich zusammen mit verschiedenen Entwicklungen, die ab etwa 140 n. Chr. erkennbar werden: dem Aufblühen der Gnosis und der Bildung autoritativer Sammlungen frühchristlicher Texte. Hinzu treten zwei historische Entwicklungen, die eine Abgrenzung um etwa 135 n. Chr. sinnvoll machen: In diesem Jahr endete der zweite Aufstand der Judäer (132–135 n. Chr.), und 138 n. Chr. starb Kaiser Hadrian. Die vorliegende Rekonstruktion einer Geschichte des frühen Christentums reicht daher von der Geburt Jesu im Jahr 4 v. Chr. bis 135 n. Chr.
Читать дальше