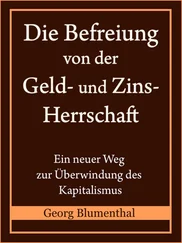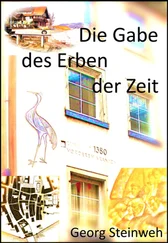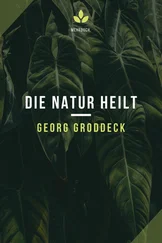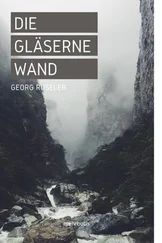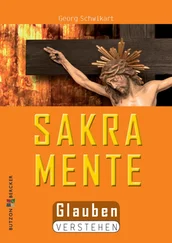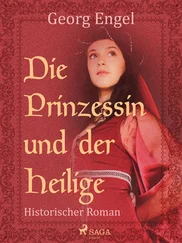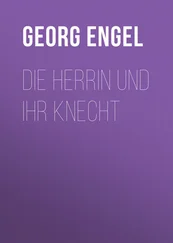1 Sie vergeuden keine Zeit, weder in der Vorbereitung noch während der Rede.
2 Sie setzen die Eckpunkte für die wichtigsten drei Phasen der Rede: Anfang, Schluss und das, was Sie selbstverständlich an Wichtigem dazwischen unbedingt bringen wollen.
3 Sie erarbeiten gezielt Bilder, Anker und Priming-Begriffe für das assoziative (unbewusste) System 1 und damit für den neurolingualen Kontext der Zuhörer wichtige Überzeugungsschritte, so dass mindestens die Mehrheit dies kollektiv positiv aufnimmt und so auch kollektiv bestärkt.
4 Sie fokussieren sich auf die individualisierten sprachlichen Mittel und Instrumente, die Ihre Zuhörer verstehen und als für sich angemessen empfinden.
 Ein gutes Beispiel:
Ein gutes Beispiel:
Die geglückteRede eines Gruppenführers der Feuerwehr zum 40-jährigen Dienstjubiläum des Feuerwehrkommandanten sollte
keinerlei Fremdwörter enthalten (die Feuerwehrleute untereinander wohl kaum verwenden), wohl aber Begriffe aus der „Gruppenfachsprache“ einsetzen („Wasser marsch“, „C-Rohr“ o.ä.)
einfache Satzstrukturen verwenden
an gemeinsame Erlebnisse und unvergessliche Feuerwehreinsätze erinnern
zwei populäre Zitate verwenden
mit neurolingualer Intervention die Kernbotschaften ansprechen, die bei jedem Zuhörer zu diesem Anlass unbewusst assoziativ aktiviert sind: sei treu, sei ein Kamerad, sei hilfsbereit, sei ehrlich, sei uneigennützig
im Appell „so ist er“ auch den Zuhörer in der unbewussten Selbstreflexion „so will und so kann ich auch sein“ ansprechen
Klarheit über die Zielgruppe, Erarbeitung der Kernbotschaften, inhaltliche Prägnanz – es ist offensichtlich, dass solche Pluspunkte im wahrsten Sinn „erdacht“ werden müssen. Wer glaubt, er könne intuitiv und aus dem Stegreif so weit kommen, ist erfahrungsgemäß auf dem Holzweg. Am selben Beispiel lassen sich leicht die Folgen einer ungenügenden Vorbereitung demonstrieren.
 Ein schlechtes Beispiel:
Ein schlechtes Beispiel:
Die gescheiterteRede eines Gruppenführers der Feuerwehr zum 40-jährigen Jubiläum des Feuerwehrkommandanten sollte
Fremdwörter enthalten – der Redner will ja seine Bildung heraushängen lassen und den Kameraden zeigen, wie unterbelichtet sie sind
komplizierte, lange Satzstrukturen verwenden, denen kein Zuhörer folgen kann
an zufällig memorierte Erlebnisse erinnern, mangels Vorbereitung aber wichtige und unvergessliche Feuerwehreinsätze nicht erwähnen
keine Zitate verwenden
ohne neurolinguale Intervention zu wenige Kernbotschaften ansprechen und damit die unbewussten Assoziationen der Zuhörer ungenutzt lassen – vielleicht allenfalls: „Hans – du altes Haus, du bist eine ehrliche Haut und dafür mögen wir dich alle!“
im Appell „so ist er“ verharren und die Zuhörer nicht weiter in der unbewussten Selbstreflexion ansprechen
Was läuft hier falsch? Der Redner vernachlässigt, was die Hörer erfahren wollen; die Kernbotschaften entfallen oder werden auf unverbindliche Belanglosigkeiten reduziert. Genauso ist es mit der inhaltlichen Prägnanz, die der routinierten Plattitüde weichen muss. Dies ist auch für den Zuhörer erfahrungsgemäß erkennbar – der Hörer „spürt“ geradezu, ob ein Redner vorbereitet ist oder ob er das Risiko der Improvisation eingegangen ist und damit eine vertane Rede bewusst in Kauf genommen hat. Die Reaktion der Zuhörer bei einem derartigen „Phrasendreschen“ ist verheerend: Das unbewusste System 1 kommt in seiner Analyse mit „verfügbaren Erfahrungen“ zum Schluss: „alles schon mal gehört“, „das ist nicht neu“, „das sagt ja jeder“. Das bewusst arbeitende (und bekanntermaßen eher faule) System 2 nutzt dieses Urteil zum Abschalten mit der vernichtenden Begründung: Der ist es nicht wert, dass man ihm zuhört. Konsequenz: abwesende Gesichter, verstohlene Blicke zum Smartphone oder zur Uhr, zufallende Augen – und zum Schluss freundlicher Applaus der vernichtenden Art …
Ganz fatal wirkt sich das bei Redekandidaten aus, die eigentlich auf ein „kreatives Redeerlebnis“ angewiesen wären, weil mit der Rede etwa ein beruflicher Aufstieg verbunden wäre, zum Beispiel bei der Präsentation eines Papers auf einem wissenschaftlichen Kongress. Diese karriererelevante Kreativität benötigt eben in der Regel auch Zeit. Wer sich diese Zeit nicht nimmt und unvorbereitet in einen Vortrag stolpert, wird dann glatt doppelt bestraft: Die gelungene Pointe, das einprägsame Bild und das unvergessliche Zitat waren wieder einmal in der Kürze der „Panikvorbereitung“ nicht auffindbar, und System 1 und 2 der Zuhörer (in diesem Fall erfahrungsgemäß Konkurrenten und potenzielle Mitglieder der nächsten Berufungskommission) kommen zum Urteil: „Langweiler“ – dieses Urteil ist kollektiv! Der Redner weiß um dieses Urteil auch – zumindest uneingestanden auf der unbewussten Ebene. Diese Frustrationserfahrung motiviert in den meisten Fällen nicht dazu, es beim nächsten Mal besser zu machen, sondern verstärkt eher die Redeaversion des Redners, die sich so zu einer waschechten Logosthenie auswachsen kann (s. dazu unten Kapitel X.).
2. Die kluge Vorbereitung – sammeln, prüfen und sortieren
Die Pädagogik kennt seit Jahrhunderten einen auch für die Vorbereitung von Vorträgen geltenden Erfahrungssatz: Einmal selbst geschrieben ist mehr als siebenmal gesprochen oder gelesen. Dieser Wert kann sicher nicht exakt verifiziert werden (erfahrungsgemäß ist er wohl eher noch größer). In jedem Fall sprechen für die schriftliche Ausarbeitung der wesentlichen Passagen einer Rede im Voraus einige Vorteile. So gibt es für die Vorbereitungeinige Faustregeln:
Nehmen Sie sich die Zeit für eine sorgfältige Gliederung(s.u. Kapitel V.).
Denken Sie in Richtung Ihres Redeziels die Argumente und auch die Gegenargumentedurch. Bedenken Sie dabei: Nichts ist nach dem Gesetz der Dialektik alternativlos – es gibt immerGegenargumente!
Ein prominentes Beispielfür die Missachtung dieser Regel ist Angela Merkel. Schon bald nach ihrer Wahl, insbesondere aber in der Weltwirtschaftskrise nach der Lehman-Pleite, der Eurokrise mit der Griechenlandpleite und auch später in der Flüchtlingskrise verwendete sie gerne die Argumentation, ihr Handeln sei „alternativlos“ – und zwar mit derartiger Penetranz, dass eine frustrierte Öffentlichkeit das Wort „alternativlos“ sogar zum Unwort des Jahres 2010 wählte. Heike Göbel erklärt das in ihrem Kommentar in der FAZ-Netausgabe vom 18. Januar 2011 so: „Mit dem Etikett ‚alternativlos‘ stellt sich Politik als ohnmächtiges Vollzugsorgan eines von höherer Macht bestimmten Schicksals hin. Das schafft Verdruss beim Wähler. Warum soll er überhaupt noch seine Stimme abgeben, wenn Regierungshandeln so alternativlos ist, wie behauptet?“ Und die Jury des „Unwort des Jahres“ ergänzt: „Das Wort suggeriert sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe. Behauptungen dieser Art sind 2010 zu oft aufgestellt worden, sie drohen, die Politik-Verdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken.“ ( www.unwortdesjahres.net)
Nutzen Sie auf der Suche nach zusätzlichen Argumenten auch die gängigen Kreativtechniken, die Ihnen persönlich weiterhelfen: Ob Brainstorming, Mind-Mapping, „Fundgrubensuche“ oder was auch immer – der Zuhörer ist für jedes bislang ungehörte Zitat oder ein weiterführendes und erhellendes Argument dankbar und spürt die Sorgfalt, mit der sich der Redner auf ihn vorbereitet hat.
Читать дальше
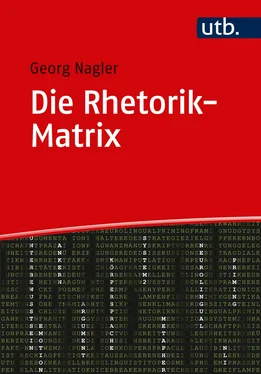
 Ein gutes Beispiel:
Ein gutes Beispiel: