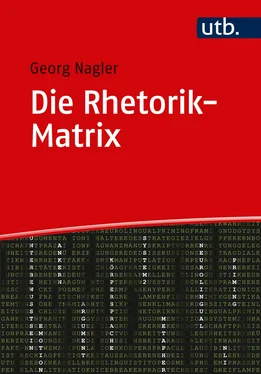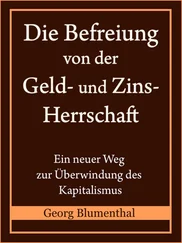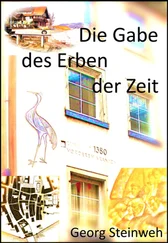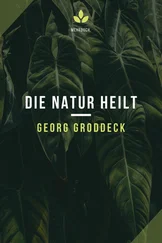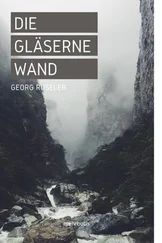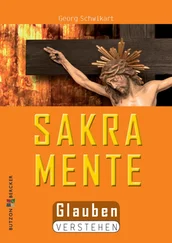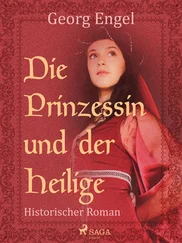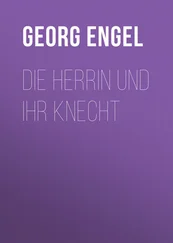Man gibt Zuhörern das Gefühl, Macht zu haben
Man präsentiert den Zuhörern eine Geschichte, die sie als kohärent und plausibel bewerten können und daraufhin zur vom Redner gewünschten Einstellung gelangen
Zuhörer werden daran erinnert, dass sie hohes Vertrauen in ihre Intuition haben können – oder aber:
Zuhörer werden daran erinnert, dass sie ihrer Intuition misstrauen sollten. Mit der Erkenntnis, dass ihre intuitiv vorhandenen Urteile auf struktureller Selbstüberschätzung und verzerrter Wahrnehmung beruhen, wächst die Bereitschaft, stattdessen dem Redner zu glauben.
Die neurolinguale Intervention sollte behutsam erfolgen und am besten so unterschwelligausgeprägt sein, dass sie das bewusst arbeitende System 2 nicht aktiviert und zu Zweifeln anregt. Eine wesentliche Rolle für eine effiziente unterschwellige Intervention spielt die Körpersprache, auf die wir noch intensiv eingehen werden. Solange diese Körpersprache als authentisch empfunden wird, als glaubwürdiger „nonverbaler Begleitkontext“ einer Rede, ist System 1 nicht veranlasst, argwöhnisch oder skeptisch zu reagieren. Der Redner ist dann offensichtlich so, wie er redet – und diese Kongruenz wirkt doppelt, da sie unbewusst die Neigung verstärkt, dem Gegenüber Glauben zu schenken.
Die NLI kann eine Fülle der typischen „heuristischen Fehler“ (Bias) des unbewusst arbeitenden Systems 1 geschickt in die eigene Argumentation einbauen. Damit wird eine Rede zwar nicht „wahr“ – aber kohärenter und plausibler.
Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele, die Econs sprachlos machen; zitiert sei ein besonders krasses, das von Humans in der Fernsehwerbung aber schlichtweg als wahr akzeptiert wird: Es ist die „Verivox“-Werbung der Jahre 2015/2016 zu Strompreisvergleichen mit den Geissens. Es gibt zuerst die zwar richtige, aber typisch „leicht doof“ ausgesprochene Feststellung von Frau Geissen: „Wer vergleicht, kann beim Verbrauch sparen.“ Der zentrale Antwortsatz des „verschlagen-schlauen“ Herrn Geissen lautet: „Und wer mehr verbraucht, spartauch mehr“ – dazu lacht er sein Kapitalistenlachen und schaltet das Flutlicht für den Swimmingpool ein. Es stellt sich nun die Frage, ob die Geissens tatsächlich mehr sparen, wenn sie mehr verbrauchen, und sich daher auch mehr leisten können. Diese Frage wurde von den meisten von mir befragten Studenten in einer – sicher nicht repräsentativen – Umfrage für richtig gehalten. Obwohl diese Schlussfolgerung zumindest konkret leicht widersinnig ist: Wer mit Flutlicht seinen Pool beleuchtet, der spart nicht, sondern verbraucht aberwitzig viel Strom und wirft das Geld buchstäblich zum Fenster hinaus!
Man kann nun weiter fragen: Warum glauben die Zuseher den Spruch von Herrn Geissen „Wer mehr verbraucht, spart auch mehr“? Vieles hat schlicht mit dem „Erfolgssetting“ der Millionärsfamilie Geissen zu tun, die als zwar etwas schlicht empfunden wird, gerade deswegen aber auch als glaubwürdig. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen: Wenn Sie einen erfolgreichen Millionär zitieren, dann ist die Neigung, das für wahr zu halten, was er sagt, überdurchschnittlich hoch (der Bias des sogenannten Halo-Effektes, vgl. Kahneman, S. 254, s.a. Dobelli, S. 157f.).
Wir werden solche Bias-Manipulationen im Folgenden noch häufig ansprechen, weil sie eben rhetorisch enorm wichtig sind.
Das unbewusste System 1 und das bewusste System 2 haben eine Schwäche: Sie können nicht allzu viel von dem Gehörten merken und so abspeichern, dass die Erinnerung daran nachhaltig bestehen bleibt. Diese Erkenntnis erlebt jeder von uns, wenn er ein Gedicht auswendig lernen soll. Die Konsequenz für eine Rede ist offensichtlich: Beide Systeme des Zuhörers übernehmen geradezu dankbar plausible, klare und leicht memorierbare Botschaften für ihren Denkprozess. Dies ist der eigentliche Kern für die allgemeine Weisheit der praktischen Rhetorik: Konzentrieren Sie sich auf drei bis maximal fünf Aussagen, die man für wichtig hält – mehr kann man nicht im Kopf behalten. Diese „Merkweisheit“ gilt übrigens für beide – den Zuhörer und den Redner!
Dabei sollten Sie als Redner sorgfältig vorbereiten, wie Sie Ihre Merksätze im Kopf des Zuhörers verankern: Nur wenn das Aufgenommene in einer „merkfähigen“ Übereinstimmung zum assoziativen Denk- und Verarbeitungssystem des Zuhörers steht, ist der „Merkerfolg“ sicher. Dies kann übrigens auch so passieren, dass die Rede genau das Gegenteil von dem trifft, was ein Zuhörer über ein Thema annimmt; dass also etwas Dargestelltes derart weit weg vom Gewussten liegt, dass es geradezu eine komische Note annimmt – und dann gerade deswegen einprägsam wird.
Ein Beispielist die – zumindest für jeden erwachsenen Bayern und Deutschen – berühmte Rede des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zur Vision des Transrapid in München: „In 10 Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen“. Diese Rede bedient die dargelegte These der leichteren Merkbarkeit doppelt: Edmund Stoiber formuliert darin wiederholt die für einen Zuhörer schier unmögliche Vorstellung: „Sie checken am Hauptbahnhof München ein und sind in 10 Minuten am Flughafen“; sie kann durch diese Wiederholung leichter im Gedächtnis verankert werden. Und sie ist dank Stoibers rhetorischer Performance des hilflosen Faselns von einer derartigen selbstsatirischen Absurdität, dass daraus ein unvergesslicher Witz wird.
Viele der rhetorischen Stilformeln beruhen in ihrer Wirksamkeit auf dieser Regel: Sie sind in ihrer Prägnanz leicht merkbar und können buchstäblich bildlich gesehen werden – wir werden dies noch eingehend analysieren.
Zusammenfassung
Wie wir gesehen haben, gibt es viele neurolinguale Einzelelemente, die ein geschickter Redner als Instrumentenkasten für seine erfolgreiche Rede verwenden kann. Die Basis ist das rhetorische Wissen; ihm muss die rhetorische Übung und sorgfältige Vorbereitung des eigenen rednerischen Auftrittes folgen. Nicht umsonst heißt es seit Jahrtausenden: „poeta nascitur, orator fit“: Zum Dichter wird man geboren, zum Redner hingegen kann man geschult werden. Die Übung des wirkungsvollen Auftritts, der richtigen Körpersprache und einer „gefälligen“ Argumentation entfaltet in Verbindung mit modernen Erkenntnissen der NLI ihre Wirkung. Dies wollen wir nun bei einer Fülle von Einzelpunkten als Teilelementen der Rhetorik-Matrix im Folgenden bearbeiten.
Vorbereitung
IV. Die richtige Strategie für eine Rede = die richtige Vorbereitung einer Rede
„Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will.“
(Michel de Montaigne, 1533–1592)
Wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon passiert: Sie wussten, dass Sie eine Rede oder einen Vortrag (z.B. 25 Minuten lang) halten mussten – aber zwischen Ihnen und der Rede lag ein furchterregendes Tier: der innere Schweinehund. Immer wenn Sie an die Rede dachten, hielt dieses Tier Sie von einer Ausarbeitung ab – bis endlich 48 Stunden vor dem Termin der Panikmodus Sie endlich dazu brachte, dieses Vieh zu vertreiben. Schnell zimmerten Sie eine Gliederung und machten sich an drei bis fünf Gedanken, Sie vergaßen ein Zitat nicht und schrieben zwei Seiten mit Ihren Ideen handschriftlich voll. Mit gemischten Gefühlen gingen Sie in die Veranstaltung – „es wird schon gut gehen“ –, nach ein paar Versprechern und nervösem Haspeln ging es dann halbwegs passabel weiter und am Schluss erhielten Sie einen freundlichen Applaus (der vielleicht ein wenig länger hätte ausfallen können). Und auf die drängende Frage „Wie war ich?“ (sie ist als Kalauer bei Männern und Rednern zentral) folgt das nett gemeinte „war o.k.“ Ihrer Kollegen oder Kommilitonen, was im ganzen Satz ungefähr bedeutet: „Dein Vortrag war so durchschnittlich wie der Beitrag einer langweiligen Tagesschau“. Es bleibt eine kurze Erleichterung und das fade Gefühl: Bei diesem Auftritt wäre mehr drin gewesen. Und trotz dieser Erfahrung geht das gleiche Spiel beim nächsten Vortrag wahrscheinlich wieder von vorne los.
Читать дальше