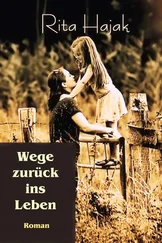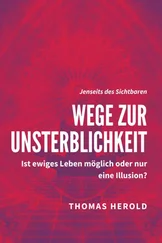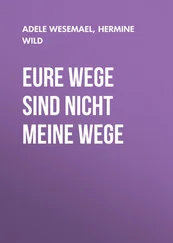D. 50.16.195.1 Ulpianus 46 ad edictum„Familiae“ appellatio qualiter accipiatur, videamus. et quidem varie accepta est: Nam et in res et in personas deducitur. in res, ut puta in lege duodecim tabularum his verbis „adgnatus proximus familiam habeto“. […].
Wir wollen betrachten, auf welche Weise die Bezeichnung familia verstanden wird. Und sie ist allerdings auf verschiedene Weise aufgefasst worden: Sie wird nämlich sowohl auf Sachen als auch auf Personen angewendet. Auf Sachen, wie zum Beispiel im Zwölftafelgesetz, mit diesen Worten „der gradnächste agnatische Verwandte soll die familia haben“. […].
Ulpian (3. Jahrhundert n. Chr.) betont, dass sich der Begriff familia im Intestaterbrecht der Zwölftafeln auf Sachen, nicht auf Personen beziehe. Das Wort familia steht also nicht nur für die personenrechtliche Beziehung zwischen Familienangehörigen, sondern kann auch das Vermögen bezeichnen.
Aufgrund der Abhängigkeit des Intestaterbrechts von den Familienstrukturen sind im Folgenden auch die Grundsätze des römischen Familienrechts vorzustellen und in ihrer Bedeutung für das Intestaterbrecht zu würdigen.
3.1 Die Familie als Hierarchie
Die römische Familie ist – genau wie die civitas ( Kap. 2.2.2) – als Rechtsgemeinschaft definiert. Diese Gemeinschaft ist hierarchisch organisiert:
D. 50.16.195.2 Ulpianus 46 ad edictum[…] iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus. […].
[…] nach eigenem Recht ( ius civile ) bezeichnen wir als Familie mehrere Personen, die entweder der Natur nach oder rechtlich der Gewalt eines einzelnen unterworfen worden sind, wie zum Beispiel den Hausvater ( pater familias ), die Mutter ( mater familias ), den Haussohn ( filius familias ), die Haustochter ( filia familias ) und diejenigen, die der Reihe nach an ihre Stelle nachfolgen, wie zum Beispiel Enkel und Enkelinnen und so weiter. Als pater familias aber wird derjenige bezeichnet, der im Haus die Vermögensgewalt innehat, und richtigerweise wird er auch mit diesem Namen bezeichnet, wenn er auch kein Kind hat. Wir bezeichnen nämlich nicht allein seine Person, sondern auch die Rechtsstellung. […].
Familie im Sinne des ius civile ist ein Personenverband, welcher der Gewalt eines Oberhaupts untersteht. Das Oberhaupt der römischen Familie ist der Hausvater ( pater familias ), der die anderen Angehörigen der Familie in seiner Gewalt hat. Dabei ist zu beachten, dass die väterliche Gewalt auch für die Abkömmlinge der Haussöhne gilt, also generationsübergreifend wirkt. Solange also der Großvater lebt, stehen seine Söhne und deren Kinder in seiner Gewalt. Da einem Haussohn mit dem Ausscheiden aus der väterlichen Gewalt die Möglichkeit eröffnet wird, selbst Oberhaupt einer Familie zu sein, wird er als pater familias („Hausvater“) bezeichnet, sobald er aus der Gewalt des Vaters ausscheidet. Diese Bezeichnung gilt unabhängig davon, ob der aus der Gewalt Ausscheidende verheiratet ist oder Kinder hat; sie kennzeichnet also nur die eigene Unabhängigkeit von der väterlichen Gewalt. Bei Enkeln ist zu beachten, dass sie mit dem Tod des Großvaters in die Gewalt ihres Vaters übergehen, also ihrerseits nicht rechtlich selbstständig werden, sondern nur den Gewalthaber wechseln.
Die Hausgewalt des Hausvaters ( patria potestas ) umfasste ursprünglich das Recht, über Leben und Tod der Abkömmlinge zu entscheiden; noch in der Zeit des Prinzipats beinhaltet sie die Befugnis zur Aussetzung von neugeborenen Hauskindern. Vermögensrechtlich führt die Gewaltunterworfenheit zur Vermögensunfähigkeit: Hauskinder erwerben durch Geschäfte nicht für sich selbst, sondern – gleichsam als „verlängerter Arm“ des Hausvaters – nur mit Wirkung für diesen. Aus diesem Verständnis der Hausgewalt erklärt sich, warum die familia in einem weiteren Sinne auch die Sklaven erfasst: Auch sie stehen in der Gewalt des Hausvaters und erwerben – genau wie die Hauskinder – mit Wirkung für diesen:
Gai. 2,87Igitur liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod servi nostri […] nanciscuntur […] id nobis adquiritur […]; et ideo si heres institutus sit, nisi nostro iussu hereditatem adire non potest; et si iubentibus nobis adierit, hereditas nobis adquiritur, proinde atque si nos ipsi heredes instituti essemus; et convenienter scilicet legatum per eos nobis adquiritur.
Was also unsere Hauskinder, die wir in der Hausgewalt haben, ebenso was unsere Sklaven […] erlangen, […] das wird für uns erworben, […]. Und daher kann er [derjenige, der in der Hausgewalt ist], wenn er zum Erben eingesetzt worden ist, nur auf unser Geheiß hin die Erbschaft antreten […]; und wenn er sie auf unseren Befehl hin angetreten hat, wird die Erbschaft für uns ebenso erworben, wie wenn wir selbst zu Erben eingesetzt worden wären; und dementsprechend wird – wie sich versteht – ein Vermächtnis durch sie für uns erworben.
Sowohl Sklaven als auch Hauskinder erwerben für den pater familias . Dies gilt auch für den erbschaftlichen Erwerb: Ist ein Haussohn oder eine Haustochter im Testament eines Dritten zum Erben eingesetzt oder ist ihnen ein Vermächtnis zugedacht worden, entscheidet der Hausvater, ob das Erbe anzutreten oder das Vermächtnis anzunehmen ist. Die Hauskinder erwerben die Erbschaft also nicht für sich selbst, sondern für den Hausvater als Inhaber des Familienvermögens.
Voraussetzung für die Begründung der Hausgewalt ( patria potestas ) über die Kinder ist das Bestehen einer rechtmäßigen römischen Ehe zwischen den Eltern:
Gai. 1,55Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus, quod ius proprium civium Romanorum est. […].
Ebenso stehen unsere Kinder, die wir in rechtmäßiger Ehe gezeugt haben, in unserer Hausgewalt ( potestas ). Dieses Recht ist den römischen Bürgern vorbehalten. […].
Eine rechtmäßige Ehe setzt voraus, dass beide Eheleute das römische Bürgerrecht haben. Mit Nichtrömerinnen kann ausnahmsweise dann eine nach römischem Recht gültige Ehe eingegangen werden, wenn ihnen das Privileg der Eheeingehung nach römischem Recht, das conubium , verliehen worden ist.
Das Gewaltverhältnis – das heißt die Vermögensunfähigkeit des Hauskindes – endet grundsätzlich erst dann, wenn der Gewalthaber verstirbt:
D. 50.16.195.2 Ulpianus 46 ad edictum[…] Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: Singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. […].
[…] Und wenn der pater familias verstirbt, beginnen die Personen, wie viele auch immer ihm unterworfen gewesen sind, einzelne Familien zu haben; denn jeder einzelne von ihnen übernimmt den Namen pater familias . […].
Mit dem Tod des Hausvaters werden die Hauskinder gewaltfrei und vermögensfähig; dabei wird nicht zwischen Haussöhnen und Haustöchtern unterschieden. Ein Unterschied zwischen Haussöhnen und Haustöchtern ergibt sich aber daraus, dass Haussöhne selbst Hausgewalt über in rechtmäßiger Ehe geborene Abkömmlinge begründen können, während die Haustöchter lediglich Gewalt über sich selbst erlangen ( Kap. 3.1.4).
Aus diesem Nachrücken der Hauskinder in die Position des Hausvaters bei dessen Tod ergibt sich die erste Stufe der römischen Intestaterbfolge nach ius civile . Der bereits zitierte Zwölftafelsatz V,4 sieht vor, dass der testamentslose Erblasser von seinem Hauserben ( suus heres ) beerbt wird: „Wenn jemand, der keinen Hauserben hat, testamentslos stirbt, […]“ ( si intestato moritur, cui suus heres nec essit [ … ].). Die Rechtsnachfolge der Hauskinder in die Stellung des Hausvaters wird dabei nicht angeordnet, sondern vorausgesetzt.
Читать дальше