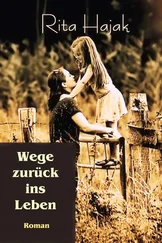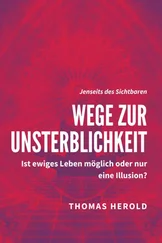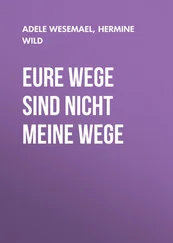1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 2.2.3 Ius praetorium und ius honorarium
Das ius praetorium oder ius honorarium bildet die zweite wichtige Rechtsschicht des vom Menschen geschaffenen Rechts:
D. 1.1.7.1 Papinianus 2 definitionumIus praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.
Das prätorische Recht ist dasjenige, das die Prätoren um der Unterstützung oder der Ergänzung oder der Korrektur des ius civile willen zum öffentlichen Wohl eingeführt haben. Dieses wird auch als ius honorarium bezeichnet, das zu Ehren ( honor ) der Prätoren so genannt wurde.
Der Name ius praetorium leitet sich vom Amt des Gerichtsmagistraten ( praetor oder allgemeiner honor = „Amt“, daher auch „Amtsrecht“) ab, verweist also darauf, dass das Recht auf dem prätorischen Edikt beruht. Sein Zweck ergibt sich aus dem Rechtsdurchsetzungszweck des prätorischen Edikts: Das Edikt stellt die Klageformeln und Einreden zur Verfügung, die Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsschutz sind. Aus diesem Grund wird das ius praetorium vorrangig in seiner Funktion für das ius civile , verstanden als Summe der für den römischen Bürger geltenden Rechtsgrundsätze und Rechtsinstitute, definiert. Das prätorische Recht als Prozessrecht des ius civile dient in dieser Perspektive zunächst dazu, das ius civile zu unterstützen und bei dessen Lückenhaftigkeit zu ergänzen. Der vom Prätor gewährte Rechtsschutz kann aber auch eine das ius civile korrigierende Funktion haben. Auch diese Korrekturwirkung kann – wie das gesamte ius praetorium – aus dem öffentlichen Auftrag des Prätors gerechtfertigt werden.
Auf diese Weise besteht tendenziell ein Spannungsverhältnis zwischen ius civile und ius praetorium . Diese Dualität beider Rechtsschichten dauert auch nach Beginn des Prinzipats fort. Obwohl das Edikt seit Kaiser Hadrian (117 – 138 n. Chr.) als kaiserliches Recht wirkt ( Kap. 2.1.2), wird es in den Juristenschriften weiter als ius praetorium bezeichnet. Auch das ius civile wird bis in die Kaiserzeit als eigenständige Rechtsschicht angesehen, wenngleich das Kaiserrecht auch für dieses neue Vorgaben setzt und unmittelbar verändernd in das ius civile eingreift.
2.2.4 Ius civile und ius novum im Prinzipat
Das Kaiserrecht, verstanden als dritte Rechtsschicht des menschlich geschaffenen Rechts, besteht aus Senatsbeschlüssen ( senatusconsulta ) und kaiserlichen Konstitutionen ( constitutiones ). Beiden Rechtssetzungsakten kommt nach Meinung der kaiserzeitlichen Juristen Gesetzeskraft zu:
Gai. 1,4Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis [de ea re] fuerit quaesitum.
Ein Senatsbeschluss ist, was der Senat befiehlt und festsetzt. Und dieser erhält die Aufgabe eines Gesetzes, obwohl diese Wirkung in Frage gestellt wurde.
Als Senatsbeschluss ( senatusconsultum ) wird eine verbindliche Anordnung des Senats bezeichnet. Gaius (2. Jahrhundert n. Chr.) erkennt ihr Gesetzesgleichheit zu, wobei er andeutet, dass diese Wirkung umstritten war. Diese knappe Bemerkung spielt auf die Entwicklung des Senats zu einem Gesetzgebungsorgan des princeps an: In der Republik war der Senat die Versammlung der früheren Höchstmagistrate (Prätoren und Konsuln). Seine Hauptbefugnisse waren die staatsrechtliche Genehmigung ( auctoritas patrum ) von Gesetzen ( leges ) und die Erteilung von ‚Ratschlägen‘ ( consultum von consulere = „um Rat fragen“) an Magistrate. Auf Antrag des Höchstmagistraten trat der Senat zusammen, beriet und entschied über die magistratischen Anfragen. Dieses Antragsrecht vor dem Senat ( ius agendi cum senatu ) kam in der Kaiserzeit dem princeps aufgrund der tribunicia potestas ( Kap. 2.1.2) zu. Mit dem Ausbau der kaiserlichen Macht und der Dominanz des kaiserlichen Antrags ( oratio principis ) über die senatorische Diskussion wurde das senatusconsultum zur Rechtsquelle, das heißt zum allgemeinverbindlichen Rechtsakt.
Auch die mit dem Sammelbegriff als Konstitutionen (von constitutum , constituere = „festlegen“) bezeichneten weiteren Rechtssetzungen des princeps sind allgemeinverbindlich:
D. 1.4.1pr.-1 Ulpianus 1 institutionumpr. Quod principi placuit, legis habet vigorem: Utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. 1 Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas volgo constitutiones appellamus.
pr. Was dem princeps gefiel, hat Gesetzeskraft, weil ja mit dem Königsgesetz ( lex regia ), das hinsichtlich seines imperium erlassen worden ist, das Volk ihm und auf ihn all seine Befugnis und Macht überträgt. 1 Es steht daher fest, dass alles, was der Herrscher folglich durch einen Brief und eine Subskription festgelegt hat oder als Gerichtsherr geurteilt oder durch formlosen Zwischenbescheid befunden hat oder durch Edikt festgelegt hat, Gesetz ist. Dies sind diejenigen Dinge, die wir gemeinhin Konstitutionen nennen.
Die Verbindlichkeit der Konstitutionen wird von Ulpian (3. Jahrhundert n. Chr.) darauf zurückgeführt, dass der princeps selbst durch ein Königsgesetz ( lex regia ) in seine Amtsbefugnisse eingesetzt worden sei. Es liegt nahe, dieses Königsgesetz mit einem Antrittsgesetz ( lex de imperio ) in Verbindung zu bringen. Ein solches ist für den Kaiser Vespasian (69 – 79 n. Chr.) auf einer Bronzetafel überliefert, aber auch für andere Kaiser zu vermuten. Mit diesem Antrittsgesetz werden dem neuen princeps von Volk und Senat die kaiserlichen Machtbefugnisse zugestanden. Da das Volk und der Senat Gesetzgeber sind – so Ulpians Argument –, erhält der princeps gleichfalls die Kompetenz eines Gesetzgebers.
Von den genannten Konstitutionen sind zunächst die Edikte ( edicta ) zu betrachten: Während das Edikt in der Republik die Anordnung eines Magistraten in seinem Kompetenzbereich bezeichnet, mit der die Grundzüge der Amtsführung festlegt werden ( Kap. 2.1.1), kommt dem princeps als Inhaber des imperium proconsulare maius et infinitum die Befugnis zu, generell verbindliche Edikte zu erlassen. Das bekannteste und vielleicht wichtigste dieser Edikte ist die unter Kaiser Caracalla 212 n. Chr. erlassene constitutio Antoniniana (von Antoninus = Caracalla), durch die allen Bewohnern des römischen Reiches das römische Bürgerrecht verliehen wird.
Dagegen sind die übrigen Konstitutionen ihrer Natur nach Einzelfallentscheidungen. Die wichtigsten sind die Reskripte ( rescripta , von rescribere = „zurückschreiben, schriftlich antworten“), das heißt Rechtsauskünfte, welche die kaiserliche Kanzlei auf Anfrage erteilt. Die genaue Form des Reskriptes richtet sich nach seinem Adressaten: Das Reskript erfolgt in Briefform ( epistula ), wenn sich der Bescheid an bedeutende Persönlichkeiten, Beamte des Kaisers oder eine Gemeinde richtet. Allen übrigen Privatleuten wird der kaiserliche Bescheid dagegen formlos auf dem Anfrageschreiben mitgeteilt, was den Namen subscriptio (wörtlich: „Unterschrift“) erklärt. Verbindlich war diese Auskunft zunächst nur für den Sachverhalt, auf den sich die Anfrage bezog; der gegenüber dem Kaiser niederrangige Entscheidungsträger, zum Beispiel ein Richter, ist also bei seiner Entscheidung an die kaiserliche Rechtsauskunft gebunden. Darüber hinaus erhalten Reskripte präjudizielle Wirkung, indem sie auch in Rechtsstreitigkeiten zitiert werden, die zwar nicht Anlass für die Anfrage waren, aber eine vergleichbare Rechtsfrage betreffen. Eine vergleichbare Wirkung kommt den vom Kaiser als Gerichtsherrn erlassenen Urteilen ( decreta ) oder Zwischenbescheiden ( interlocutiones ) zu, da sie über den Einzelfall hinaus als Präjudizien verwendet werden.
Читать дальше