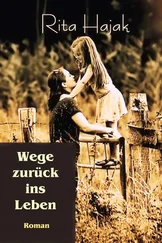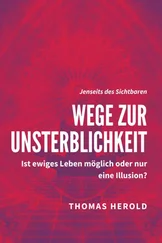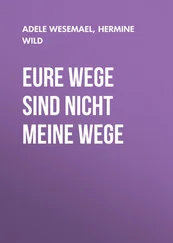Wenn also kein Bruder des Verstorbenen vorhanden ist, es aber Kinder von Brüdern gibt, so steht zwar allen die Erbschaft zu; aber es wurde in Frage gestellt, wenn zufällig Kinder unterschiedlicher Anzahl geboren waren (so dass von einem Bruder ein oder zwei, vom anderen drei oder vier Kinder [abstammten]), ob die Erbschaft nach Stämmen zu teilen sei, wie es bei den Hauserben rechtens ist, oder eher nach Köpfen. Dennoch hat man es schon seit langer Zeit für gut befunden, dass die Erbschaft nach Köpfen zu teilen sei. Deshalb wird die Erbschaft in so viele Teile geteilt werden, wie viele Personen auf beiden Seiten vorhanden sind, so dass auf diese Weise jeder Einzelne je einen Teil erhält.
Sind agnatische Verwandte des ersten und des zweiten Grades (Geschwister des Erblassers) vorverstorben, kommen die Agnaten des dritten Grades zum Zug. Sind als solche insgesamt fünf Kinder von zwei vorverstorbenen Brüdern, also Neffen oder Nichten des Erblassers, vorhanden, sind sie alle als gradnächste Agnaten berufen. Würde man das Stammesprinzip – wie bei Hauserben – zur Geltung bringen, müssten die Neffen oder Nichten den jeweiligen Erbteil ihres Vaters unter sich aufteilen. Da bei der agnatischen Verwandtschaft das Erbe aber nicht nach Stämmen, sondern nach Köpfen geteilt wird, erhält stattdessen jeder Neffe und jede Nichte den Kopfteil, das heißt ein Fünftel (1/5) der Erbschaft.
3.1.4 Das Intestaterbrecht von Frauen
Zwar sind Haustöchter gleichberechtigt neben Haussöhnen als Hauserben berufen. Wie gesehen, sind aber ihre Abkömmlinge nicht in der Vatersfamilie erbberechtigt. Ebenso sind Frauen zwar als Agnaten zur Intestaterbfolge berufen, können aber mangels Gewaltverhältnis selbst keine agnatische Verwandtschaft vermitteln ( Kap. 3.1.1). Scheidet die Haustochter aus der väterlichen Gewalt aus, ist sie zwar gewaltfrei, hat aber ihrerseits keine von ihr abhängigen Verwandten:
D. 50.16.195.5 Ulpianus 46 ad edictumMulier autem familiae suae et caput et finis est.
Die Frau aber ist sowohl der Anfang als auch das Ende ihrer eigenen Familie.
Ulpian (3. Jahrhundert n. Chr.) bringt diese Situation auf den Punkt, die Familie der Frau sei auf sie selbst begrenzt. Da die (ehelichen) Kinder in der Gewalt des Vaters stehen, sind sie nach ius civile nur mit der Familie des Ehemanns verwandt. Ein verwandtschaftliches Verhältnis zu ihren Abkömmlingen konnte eine Frau ursprünglich nur dann begründen, wenn sie sich selbst in die Ehegewalt ( manus ) des Ehemanns begab:
Gai. 3,3Uxor quoque, quae in manu eius est, sua heres est, quia filiae loco est. Item nurus, quae in filii manu est, nam et haec neptis loco est. Sed ita demum erit sua heres, si filius, cuius in manu est, cum pater moritur, in potestate eius non sit. […].
Auch eine in manus stehende Ehefrau ist seine Hauserbin, weil sie im Verhältnis einer Haustochter steht; ebenso eine Schwiegertochter, die sich in der Ehegewalt des Sohnes befindet, denn auch sie steht im Verhältnis einer Enkelin. Aber sie wird nur dann Hauserbin sein, wenn der Sohn, in dessen Ehegewalt sie steht, zum Zeitpunkt des Todes des Vaters nicht in dessen Hausgewalt ist. […].
Eine in manus ihres Ehemanns befindliche Ehefrau hat den Status einer Haustochter und kann daher ihre Kinder als Schwester beerben. Steht sie in der Gewalt des Schwiegervaters, hat sie ihm gegenüber das Erbrecht einer Enkelin; sie erbt also nur dann, wenn ihr Mann, der als Haussohn erbberechtigt ist, vorverstorben ist. Obwohl die Eingehung einer manus -Ehe bereits am Ende der Republik unüblich war, wird sie von Gaius (2. Jahrhundert n. Chr.) aus didaktischen Gründen mitbehandelt: Der rechtshistorische Rückblick zeigt, dass die erbrechtliche Schlechterstellung der Ehefrau ursprünglich durch die Eingehung einer manus -Ehe vermieden werden konnte. Schloss die Frau dagegen – wie es im Prinzipat üblich war – eine Ehe, ohne sich in die Gewalt ihres Ehemanns zu begeben, war sie entweder gewaltfrei oder stand in der Hausgewalt ihres Vaters. Im letzteren Fall war sie in ihrer Herkunftsfamilie erbberechtigt, wurde also als Hauserbin (des Vaters) oder gradnächste agnatische Verwandte (zum Beispiel ihres Bruders oder Onkels) zur Intestaterbfolge berufen.
Allerdings wurde in einer nicht näher bestimmbaren Zeit nach den Zwölftafeln das Intestaterbrecht der Frauen als agnatus proximus weiter beschränkt:
Gai. 3,14[…] nostrae vero hereditates ad feminas ultra consanguineorum gradum non pertinent. Itaque soror fratri sororive legitima heres est, amita vero et fratris filia legitima heres esse non potest; sororis autem nobis loco est etiam mater aut noverca, quae per in manum conventionem apud patrem nostrum iura filiae nancta est.
[…] unsere Erbschaften stehen aber nicht denjenigen Frauen zu, die gradferner als Geschwister von der Vaterseite ( consanguinei ) verwandt sind. Daher ist eine Schwester gegenüber ihrem Bruder oder ihrer Schwester gesetzliche Erbin, eine Vaterschwester aber und eine Tochter des Bruders kann nicht gesetzliche Erbin sein; im Verhältnis einer Schwester aber steht mir gegenüber auch die Mutter oder Stiefmutter, die dadurch, dass sie in die Ehegewalt gekommen ist, bei meinem Vater die Rechte einer Tochter erlangt hat.
Frauen, die gradferner als Geschwister von der Vaterseite ( consanguinei ) waren, konnten einer juristischen Interpretation des Intestaterbrechts zufolge nicht als agnatus proximus erben. Somit waren Frauen, die mit dem Erblasser im dritten Grad verwandt waren, nicht zur Erbfolge berufen.
Auf diese Weise konnte zwar eine Schwester des Erblassers als agnatisch Verwandte erben; dagegen wurde eine Tante von der Vaterseite ebenso ausgeschlossen wie etwa eine Nichte des Erblassers, obwohl Onkel und Neffen von der Vaterseite zur Erbfolge zugelassen waren.
3.1.5 Das Erbrecht der Gentilen
Die dritte Stufe der Intestaterbfolge wird im Zwölftafelgesetz von den Gentilen (Angehörigen der gens = „Sippe“) begründet.
Gai. 3,17Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum gentiles ad hereditatem vocat. Qui sint autem gentiles, primo commentario rettulimus; et cum illic admonuerimus totum gentilicium ius in desuetudinem abisse, supervacuum est hoc quoque loco de eadem re curiosius tractare.
Wenn es keinen Agnaten gibt, beruft dasselbe Zwölftafelgesetz die Angehörigen der Sippe ( gens ) zur Erbschaft. Wer aber die Sippenangehörigen sind, habe ich im ersten Buch berichtet; und weil ich dort darauf hingewiesen habe, dass das gesamte Sippenrecht außer Gebrauch gekommen ist, ist es überflüssig, auch an dieser Stelle dieselbe Sache allzu sorgfältig zu behandeln.
Dieses Erbrecht der Sippe ( gens ) ist zur Zeit des Gaius (2. Jahrhundert n. Chr.) bereits aus der Übung gekommen. Da der Zwölftafelsatz formell fortbestand, musste Gaius in seinem Anfängerlehrbuch auf die Veränderung der Rechtslage hinweisen.
Weitergehende Veränderungen der Intestaterbfolge nach ius civile beruhen auf dem prätorischen Recht, das sich neben dem Intestaterbrecht des ius civile ausbildete.
3.2 Die Intestaterbfolge des ius praetorium
Genau wie das Erbrecht nach ius civile unterscheidet auch das prätorische Edikt danach, ob der Antragsteller den Nachlass als Testamentserbe oder als Intestaterbe beansprucht. Während das ius civile den Übergang der Rechtsinhaberschaft anordnet, erlaubt das ius praetorium dem Berechtigten zunächst nur eine faktische Inhaberschaft am Nachlass. Diese wird als Nachlassbesitz ( bonorum possessio ) bezeichnet und verschafft dem Inhaber durch das Wirken des Prätors den Besitz sowie alle wirtschaftlichen Vorteile der Erbschaft. Der Prätor kann aber „keinen Erben schaffen“ (Kap. 4.2.2). Grundlage der prätorischen Zuweisung des Nachlassbesitzes ohne Testament ( bonorum possessio ab intestato ) ist das Edikt: „Wenn keine Testamentstafeln vorhanden sein werden“ ( si tabulae testamenti nullae extabunt ). 10In diesem Edikt nennt der Prätor die Antragsberechtigten, die bei Fehlen eines Testaments die Einweisung in den Nachlassbesitz verlangen können. Dabei unterscheidet das Edikt verschiedene Klassen von Intestaterben:
Читать дальше