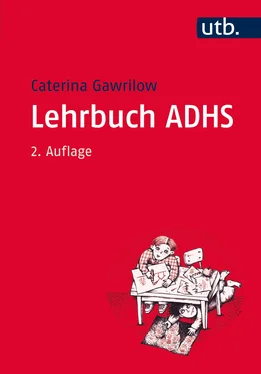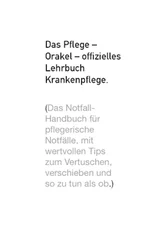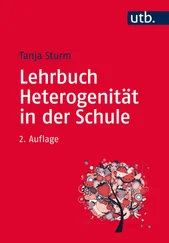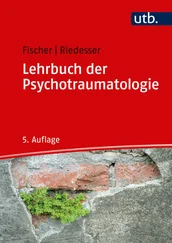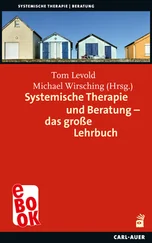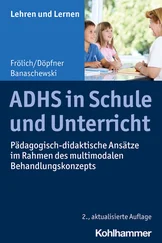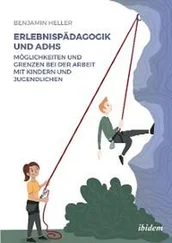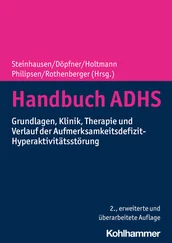1 Geschichte der ADHS
Die Geschichten vom Zappelphilipp, vom Hans Guck-in-die-Luft und dem bitterbösen Friederich dürften jedem bekannt sein. Mit diesen und anderen Geschichten aus dem „Struwwelpeter“ hat Heinrich Hoffmann, ein Frankfurter Nervenarzt, schon im Jahr 1845 Kinder beschrieben, die heutzutage mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert werden könnten. Bereits zuvor und in der Folge haben sich Mediziner und Psychologen eingehend mit der Thematik der unaufmerksamen, unkontrollierbaren, impulsiven und motorisch sehr aktiven Kinder beschäftigt.
1.1 Geschichte der ADHS
Sir George Frederick Still
Beispielhaft soll hier der englische Kinderarzt Sir George Frederick Still (1868–1941) zitiert werden. Still hat im Jahr 1902 im Rahmen der Goulstonian Lectures des „Royal College of Physicians“ in London über „Nicht normale psychische Bedingungen bei Kindern“ („Some Abnormal Psychical Conditions in Children“) gesprochen. Diese Vorlesungen wurden etwas später im Lancet, einer weltweit bekannten und führenden medizinischen Fachzeitschrift, publiziert. Dort beschrieb Still 23 Kinder, die Schwierigkeiten hatten, ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, mangelnde Selbstregulation, mangelnde volitionale Kompetenz und somit auch wenig inhibitorische Kontrolle (d. h. wenig Unterdrückung von impulsiven Reaktionen) zeigen, oft aggressiv sind und sich nicht disziplinieren lassen – obwohl ihre Intelligenz normal ausgeprägt war. Er schrieb:
“I would point out that a notable feature in many of these cases of moral defect without general impairment of intellect is a quite abnormal incapacity for sustained attention” (Still 2006, 133).

Still beschrieb einen 6-jährigen Jungen, der seine Aufmerksamkeit nicht für längere Zeit auf ein Spiel oder ähnliches richten könne. Dies sei besonders in der Schule sichtbar und führe dazu, dass der Junge schlechtere Leistungen als die anderen Kinder zeige, obwohl er im Gespräch den Eindruck eines aufgeweckten und klugen Jungen mache. Weiterhin berichtete er von einem 11-jährigen Jungen, der erhebliche Schulprobleme habe und nur schlecht lesen und rechnen könne. Außerdem sei dieser Junge extrem erregbar und reagiere auf kleinste Provokationen – auch gegenüber Kindern, die er gar nicht kenne – aggressiv.
An dieser Stelle wird der Zusammenhang zu der heute diagnostizierbaren ADHS sichtbar: Kinder mit ADHS-typischem Verhalten haben vor allem in der Schule Probleme ( Abb. 1.1). Die Vermutung liegt nahe, dass es also unaufmerksame, impulsive und wenig selbstregulierte Kinder schon immer gegeben haben muss.

Abb. 1.1: Kinder mit ADHS haben vor allem in der Schule Schwierigkeiten (Zeichnung: Vitali Konstantinov)
Auch der Hinweis auf die normal ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten deckt sich mit unserem heutigen Wissen (Gansler et al. 1998). In einer aktuellen deutschen Studie konnte dies bestätigt werden (Geißler 2009): Die Leistungen von Kindern mit ADHS wurden mittels eines Intelligenztests mit den Leistungen von Kindern ohne ADHS verglichen. Als Intelligenztest wurde der HAWIK-III (Tewes et al. 1999) verwendet, welcher im diagnostischen Alltag recht häufig zur Untersuchung der kognitiven Leistungsfähigkeit von Kindern eingesetzt wird. Der Test versteht Intelligenz als bestehend aus mehreren, voneinander unabhängigen Einzelaspekten: dem Verbal-IQ, der die sprachliche Leistungsfähigkeit erfasst, dem Handlungs-IQ, der visuell-handlungsbezogene Leistungsfähigkeit erfasst und dem Gesamt-IQ, der sich aus den Ergebnissen des Verbal- und Handlungs-IQ zusammensetzt. Es zeigte sich, dass der Verbal-IQ der Kinder mit ADHS signifikant über der Norm lag, während der Handlungs-IQ der Kinder mit ADHS signifikant unter der Norm blieb – der Gesamt-IQ der Kinder mit ADHS unterschied sich nicht signifikant von der Normstichprobe.
William James
Auch der amerikanische Philosoph und Psychologe William James (1842–1910) beschrieb in seinem 1890 veröffentlichten Werk „The Principles of Psychology“ Menschen, die ihre Impulse nicht unterdrücken und inhibieren können. Er beobachtete bei Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp eine gewisse Skrupellosigkeit, mangelndes Nachdenken über Konsequenzen, wenig gewissenhafte Überlegungen und folgerte, dass aus diesem Grund die Betroffenen ihre übermäßige (explosive) Energie entwickeln. Interessanterweise entwickelte James die Annahme, dass diese mangelnde Impulskontrolle nicht nur negative Folgen sondern auch Vorteile haben kann. Positiv formuliert interpretierte er die Reaktions-Schnelligkeit der Betroffenen als Schlagfertigkeit und war außerdem der Ansicht, dass viele revolutionäre Charaktere der Geschichte diesem Typus angehörten.
Alpha-Typ und Beta-Typ
Besonders spannend an den Ausführungen James’ ist die Annahme der mangelnden Impulskontrollfähigkeit als Persönlichkeitsfaktor. Dies findet sich in neuerer Zeit wieder: John M. Digman hat im Jahr 1997 einen Artikel publiziert, in welchem er darlegt, dass zwei übergeordnete Persönlichkeitsstrukturen allen bis zu diesem Zeitpunkt publizierten Persönlichkeitstypologien zugrunde liegen: der Alpha- und der Beta-Typ. Der Alpha-Typ ist aus seiner Sicht durch Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität, der Beta-Typ durch Extraversion und Offenheit für Neues gekennzeichnet. Untersuchungen konnten diese Zweiteilung bestätigen. So wurde beispielsweise in Genanalysen eine Bestätigung für den Beleg dieser Zweiteilung gefunden und ein Zusammenhang zu gesundheitsbewusstem Verhalten dargelegt: Menschen, die eher den Beta-Typ repräsentieren, zeigen häufiger risikobereites, gesundheitsschädliches Verhalten und Sensation Seeking (Horvath / Zuckerman 1993). Auch wenn dieses Konzept der simplen Zweiteilung von Persönlichkeiten in der Fachwelt kontrovers diskutiert wird (Ashton et al. 2009), drängt sich die Ähnlichkeit des Beta-Typs mit der ADHS-Symptomatik auf.
1.2 Ist ADHS eine Modediagnose?
Diese Frage taucht in letzter Zeit in Diskussionen um die Validität der ADHS leider immer wieder auf. Anhand der beispielhaften Darstellungen aus der Geschichte der Medizin und Psychologie muss jedoch festgestellt werden:

ADHS ist keine Modeerscheinung oder Modediagnose! In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik ADHS spielt die Frage nach dem Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein der ADHS keine Rolle mehr – die Forschung konzentriert sich aktuell vielmehr auf Fragen im Zusammenhang mit ADHS-Ätiologie, -Prävention und -Intervention (Gawrilow et al. 2011d).

Vertiefungsfragen
1. Warum ist es nicht korrekt, anzunehmen, dass Kinder mit ADHS einen niedrigeren IQ-Wert in Intelligenztests erlangen als Kinder ohne ADHS?
2. Was spricht dagegen, die ADHS als Modediagnose zu bezeichnen?
2 Kernsymptome, Stärken und Subtypen der ADHS
Die Kernsymptome der ADHS sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität – alle möglichen zu diagnostizierenden ADHS-Subtypen beziehen sich auf diese Kernsymptome. Dabei wurde mehrfach empirisch nachgewiesen, dass die Unaufmerksamkeit abzugrenzen ist von der Hyperaktivität-Impulsivität (Nigg et al. 2002). Das bedeutet, dass Unaufmerksamkeit ein singuläres Konstrukt darzustellen scheint, während Hyperaktivität und Impulsivität fast immer gekoppelt, d. h. gemeinsam, auftreten. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Annahmen zu den Subtypen der ADHS wieder. Die drei Kernsymptome der ADHS, die unterschiedlichen Möglichkeiten ADHS zu diagnostizieren sowie die Subtypen der ADHS werden in diesem Kapitel behandelt.
Читать дальше