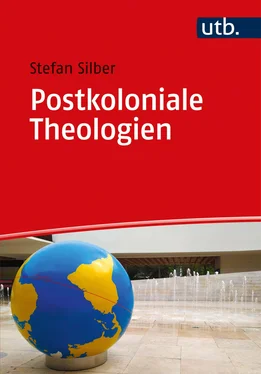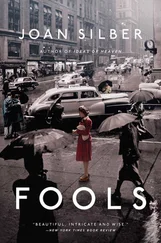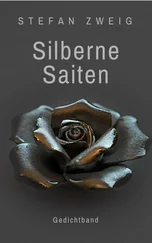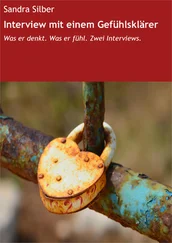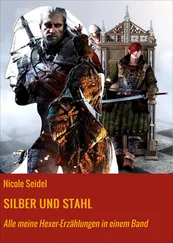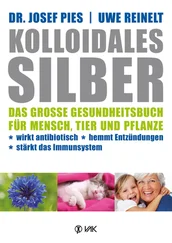Die lateinamerikanische dekoloniale Theorietradition speist sich aus den dependenztheoretischen Arbeiten der 1960er und 70er Jahre, der Weltsystem-Theorie von Immanuel WallersteinWallerstein, Immanuel und der interkulturellen Befreiungsphilosophie von Enrique DusselDussel, Enrique. Hier bestehen auch wichtige Berührungspunkte mit der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung. Da viele der ‚dekolonialen‘ AutorInnen in den USA leben und arbeiten, wird der Diskurs über diese theoretischen Ansätze sowohl in spanischer als auch in englischer Sprache geführt.
Einen streng kolonialismuskritischen Akzent erhielt die Diskussion mit der Einführung des Begriffs der ↗ ‚Kolonialität‘ durch den peruanischen Soziologen Aníbal QuijanoQuijano, Aníbal9, der in einem 1992 erschienenen Aufsatz damit die durchgängige Prägung der Denkweise ehemals kolonisierter Staaten und Kulturen bezeichnet, auch wenn die staatliche Unabhängigkeit – wie im Fall Lateinamerikas – schon seit zwei Jahrhunderten vollzogen ist. Für QuijanoQuijano, Aníbal ist diese Denkweise grundlegend im Rassismus begründet und zieht konkrete Auswirkungen auf wirtschaftliche Ausbeutung und soziale Exklusion nach sich. Später wurde der Begriff der Kolonialität in vielfacher Weise auch auf andere postkoloniale Beziehungen erweitert.10 Eine transdisziplinär arbeitende Arbeitsgruppe von WissenschaftlerInnen in Lateinamerika vertiefte unter dem Stichwort „Modernidad/Colonialidad“ oder „Modernität/KolonialitätModernität/Kolonialität“ die wechselseitigen Beziehungen zwischen der europäischen Moderne, dem Kolonialismus und der Kolonialität sowie ihre vielfältigen Konsequenzen in zahlreichen gesellschaftlichen und politischen Bereichen.11
Einer der profiliertesten Vertreter dieser Gruppe, der argentinische Literaturwissenschaftler Walter D. MignoloMignolo, Walter, verweist in seinen Arbeiten auf das prägend kolonialistische Erbe im europäischen Denken seit der Moderne und ruft zum „epistemischen Ungehorsam“12 auf. Darunter versteht er ein Denken über die von der kolonialen ↗ Epistemologie vorgegebenen Grenzen hinaus. Zahlreiche dekoloniale TheoretikerInnen greifen daher auf indigenes und afroamerikanisches Denken zurück und konstruieren von dort aus Kritiken an europäischen und kolonialen Denksystemen.13
Nicht nur in Lateinamerika ist das postkoloniale Denken sehr stark vom FeminismusFeminismus beeinflusst. Zahlreiche AutorInnen weltweit analysieren die wechselseitigen Beziehungen von Kolonialismus und Sexismus, in denen beide sich wechselseitig bestärken und aufgrund derer das koloniale Denken sich bis heute in besonderer Weise im Geschlechterverhältnis äußert. Die argentinische Anthropologin Rita SegatoSegato, Rita untersucht beispielsweise die komplexe Interdependenz zwischen Kolonialismus, Sexismus und Rassismus im Leben indigener Völker.14 Dass ein postkolonialer feministischer Diskurs auch nichtsprachliche Elemente einschließen muss, zeigt die bolivianische Soziologin Silvia Rivera CusicanquiRivera Cusicanqui, Silvia, die unter anderem Bilder, Theater, Webarbeiten und das Teilen von Essen in ihre soziologischen Arbeiten integriert.15
Heterogenes und differenziertes FeldNicht nur diese letzten Beispiele machen bereits deutlich, dass es sich bei den postkolonialen Studien um ein äußerst vielschichtiges, heterogenes und differenziertes Feld handelt. Es befindet sich auch in der Gegenwart immer noch in der Entwicklungsphase und verändert sich in dynamischer Weise. Diese Unübersichtlichkeit ist durchaus verständlich, denn die postkoloniale Kritik bezieht sich ausdrücklich auf bestimmte konkrete Kontexte, die von ihrer jeweiligen Geschichte, Kultur und Politik geprägt sind. Dass die Ergebnisse dann sehr unterschiedlich ausfallen, muss geradezu erwartet werden. Auch dass zwischen VertreterInnen postkolonialer Theorien bisweilen heftige Konflikte ausbrechen oder bestehen, kann nicht verwundern. Denn keine dieser Theorien kommt ohne einen – wie auch immer gearteten – Bezug auf die europäische Geistesgeschichte aus, während diese von ihnen ja zugleich aufs Schärfste kritisiert wird. Der indische Historiker Dipesh ChakrabartyChakrabarty, Dipesh nennt dies ein „postkoloniales Dilemma“:
„Die Gedankenwelt, die während des Zeitalters der europäischen Expansion und Kolonialherrschaft entstand, erscheint zur Beschreibung und Analyse der eigenen (nichtwestlichen) Geschichte und Gesellschaft ebenso unverzichtbar wie ungenügend.“16
GemeinsamkeitenTrotz der teils konfliktiven Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen postkolonialen Strömungen und ‚Schulen‘ lässt sich als Gemeinsamkeit zwischen ihnen erkennen, dass sie den Kolonialismus nicht nur als ein Geschehen in der Vergangenheit betrachten, sondern seine gegenwärtigen Konsequenzen (im kulturellen, epistemischen, soziologischen, wirtschaftlichen, politischen – und eben auch religiösen Bereich) als eine grundlegende Ursache von Konflikten und Problemen der Gegenwart analysieren. Diese Kritik wird heute in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen geübt, in interdisziplinären Arbeiten und in Versuchen, die starre Einteilung in wissenschaftliche Disziplinen, die ebenfalls der europäischen Geistesgeschichte geschuldet ist, zu überwinden, die Wissenschaften zu „entdisziplinieren“17.
Der Fokus auf die Kritik an Kolonialismus und Kolonialität bringt es mit sich, dass die Gefahr besteht, postkoloniale Kontexte und Kulturen auf ihre postkoloniale Kondition zu reduzieren. Auf diese Weise würde der Postkolonialismus selbst in der Falle des ↗ Eurozentrismus verbleiben. Das von MignoloMignolo, Walter und anderen eingeforderte Denken über die Grenzen hinaus und die beispielsweise von BhabhaBhabha, Homi und SaidSaid, Edward ermöglichten Perspektivwechsel in der Analyse der kolonialen und postkolonialen Beziehungen öffnen aber vielfältige Auswege aus dem Dilemma. Die theologischen Beispiele in diesem Buch werden einige dieser Auswege vorstellen und zugleich die inhaltliche und methodische Vielfalt in der Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus sichtbar machen.
Seit einigen Jahren gibt es einige sehr gute Einführungen in postkoloniale Theorien in deutscher Sprache. Insbesondere muss hier die schon klassische Einführung von María do Mar Castro VarelaCastro-Varela, María do Mar und Nikita DhawanDhawan, Nikita18 genannt werden, die inzwischen in dritter, erweiterter Auflage vorliegt. Sie ist vor allem kulturwissenschaftlich ausgerichtet und orientiert sich in erster Linie an SaidSaid, Edward, SpivakSpivak, Gayatri und BhabhaBhabha, Homi und damit an den anglophonen, asiatischen Varianten der postkolonialen Theorien.
Einen anderen Weg geht Ina KernerKerner, Ina mit ihrer stärker politikwissenschaftlich akzentuierten Einführung19, die thematisch gegliedert ist. Sie greift über den asiatischen Kontext hinaus und behandelt gezielt auch sozioökonomische Themen des Postkolonialismus. Eine gute Einführung in die Grundbegriffe der postkolonialen Studien findet sich auch in dem theologischen Sammelband von Andreas NehringNehring, Andreas und Simon WiesgicklWiesgickl, Simon (geb. TieleschWiesgickl, Simon)20. Sie setzen die Darstellung zentraler Themen der postkolonialen Theorien gleich in Beziehung mit der Theologie.
Bereits 2002 gaben Sebastian ConradConrad, Sebastian und Shalini RanderiaRanderia, Shalini einen Sammelband21 heraus, in dem Übersetzungen von wichtigen Texten der postkolonialen Studien für die deutschsprachige Öffentlichkeit bereitgestellt wurden. Sie eignen sich für einen ersten Einstieg in die globale Diskussion; die Einleitung der HerausgeberInnen verbindet diese mit deutschen und mitteleuropäischen Kontexten.
Im Sammelband „Schlüsselwerke der Postcolonial Studies“ von Julia ReuterReuter, Julia und Alexandra KarentzosKarentzos, Alexandra22 stellen deutschsprachige AutorInnen einige der auch hier schon genannten AutorInnen und Arbeiten (sowie einige weitere) vor. Darüber hinaus wird die Rezeption der postkolonialen Theorien in verschiedenen akademischen Disziplinen untersucht und besprochen. Die wichtige Frage, wie der Kolonialismus deutsche Geschichte, Kultur und Wissenschaft prägt, untersuchen zahlreiche AutorInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen in dem von Marianne Bechhaus-GerstBechhaus-Gerst, Marianne und Joachim ZellerZeller, Joachim editierten Buch „Deutschland postkolonial?“23.
Читать дальше