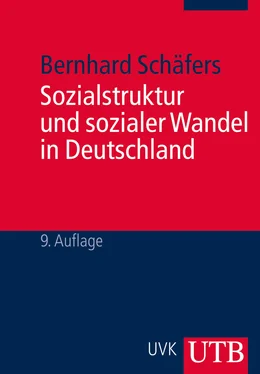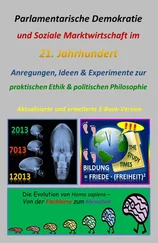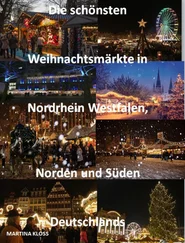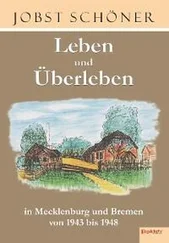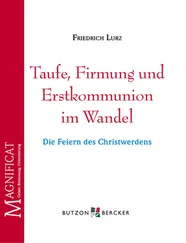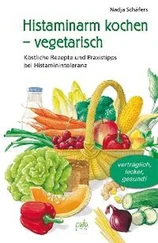Die Rationalisierung der Arbeits- und Berufswelt, des Rechts usw., in der Max Weber einen durchgängigen Trend des abendländischen Geschichtsverlaufs und der gesellschaftlichen Entwicklung sah, hat in der Verzeitlichung der Handlungsstrukturen ihre wichtigste Basis. Das verweltlichte Credo der Mönche lautete seit dem Aufkommen von Kapitalismus und Fabriksystem: Time is money (Benjamin Franklin, 1706–1790). Taschenuhren, und seit Ende des 19. Jahrhunderts Armbanduhren für immer breitere Bevölkerungsschichten sagten nun jedem, was die Stunde geschlagen hatte. Das war auch erforderlich, zumal in der Großstadt, wie Georg Simmel ausführte: »So ist die Technik des großstädtischen Lebens überhaupt nicht denkbar, ohne dass alle Tätigkeiten und Wechselbeziehungen aufs pünktlichste in ein festes, übersubjektives Zeitschema eingeordnet würden« (Simmel 1998 : 122).
Im »Prozess der Zivilisation«, den Norbert Elias (1897–1990) im hohen Mittelalter beginnen lässt, ist die zunehmende Zeitregulierung ein wichtiges Element. Zeitregulierungen als Elemente des Alltags, zu wissen, in welchem Jahr man lebt, wie alt man ist usw. sind allesamt Ergebnisse neuzeitlicher Entwicklungen (vgl. Elias 1994).
Das mit der Doppelrevolution einsetzende Zeitalter der Beschleunigung führte zu einem immer strengeren Zeitreglement, zumal am Arbeitsplatz, in den Schulen, im Verkehrswesen und damit zwangsläufig auch in der Organisation des familiären Alltags (dass das Phänomen der Beschleunigung auch semantisch seit Beginn der Doppelrevolution eine entscheidende Rolle spielt, kann man den Analysen von Reinhart Koselleck, 1989, entnehmen). Einen ersten Höhepunkt erreichte diese Entwicklung mit den Arbeitsplatz- und Zeitstudien durch Frederick W. Taylor (1856–1915), die in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg vom »Reichsausschuss für Arbeitsstudien« (REFA) verankert wurden.
In soziologischen Theorien spielt der Faktor Zeit eine sehr unterschiedliche Rolle. In einem Beitrag über die »Beziehung zwischen Zeithorizonten und sozialen Strukturen« führte Niklas Luhmann (1975) aus, dass soziale Systeme – gleich welcher Größe – Zeithorizonte institutionalisieren müssten. Zeithorizonte müssten schon deshalb sinnhaft verfügbar gemacht werden, um auf diese Weise einen Beitrag zur erforderlichen Reduktion von Komplexität zu leisten. Zu den weiteren Prämissen der Argumentation gehört, dass Zeit komplexer und reflexiver gemacht werden muss, um die erforderlichen Koordinationsleistungen in verdichteten sozialen Beziehungen überhaupt erbringen zu können.
Alle Handlungsfelder und Sozialstrukturen haben eine räumliche Dimension: Familienleben und Arbeit, Lernen, Ausbildung und Freizeit. Städte mit ihren differenzierten Raumnutzungsmustern, vom Wohnen bis zum Verkehr, sind das augenfälligste Beispiel dafür, dass das soziale Leben eine räumlich klar vorgegebene Struktur hat, zu der Grenzziehungen ebenso gehören wie öffentliche und halböffentliche Räume. Simmel arbeitete fünf Grundqualitäten des Raumes heraus, wozu gehören:
Die Ausschließlichkeit des Raumes als »Territorium«;
die Begrenzung und die Grenze;
die Fixierung und Lokalisierung von Tätigkeiten und Handlungsformen an einem Ort;
die durch den Raum mitgeprägten Bestimmungen von Nähe und Distanz und allen damit verbundenen Wechselwirkungen zwischen Individuen und daraus resultierenden Sozialverhältnissen.
Grenze und Begrenzung werden von Simmel als sozial und psychisch bedeutende Tatbestände einsichtig: »Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit sozialem Wirken, sondern eine soziale Tatsache, die sich räumlich formt« (1968 : 467). Die Differenzierung der ja auch räumlich ausgeprägten Eigentumsverhältnisse und die Zugangsmöglichkeiten zu Territorien sind für Simmel sozial wirksame Tatsachen, deren sozialstrukturelle Bedeutung offenkundig ist (vgl. auch die von Simmel ausgehende Soziologie des Raumes von Schroer, 2006).
4. Theorien und Trends des sozialen Wandels
4.1 Definition und theoretische Ansätze
Unter sozialem Wandel wird die Veränderung der Sozialstruktur einer Gesellschaft oder einzelner Bereiche in einem bestimmten Zeitraum verstanden. Sie ist verknüpft mit Veränderungen im Normen- und Wertesystem, in den Institutionen und Organisationen. Je nachdem, wie schnell sich die Basisstrukturen einer Gesellschaft verändern, spricht man von langsamem oder beschleunigtem Wandel.
Sozialer Wandel wurde mit dem Werk »Social Change« von William F. Ogburn (1886–1959) zu einem Grundbegriff der Soziologie. Ogburn verband ihn mit seiner These vom cultural lag. »Ein cultural lag tritt ein, wenn von zwei miteinander in Wechselbeziehungen stehenden Kulturelementen das eine sich früher oder stärker verändert als das andere und dadurch das zwischen ihnen bisher vorhandene Gleichgewicht stört« (Ogburn 1967 : 328). Ogburn ging davon aus, dass der Motor des sozialen Wandels im Erkenntnisfortschritt der Natur- und Ingenieurwissenschaften und deren Umsetzung in technischen Innovationen liegt. In ihrem Kern ähnelt die These der von Karl Marx über das Verhältnis von materieller Basis, den Produktivkräften, und dem Überbau von Recht und Politik, Moral und Kultur, der entsprechend dem Produktionsfortschritt angepasst werden muss.
Die um das Jahr 1970 einsetzende digitale Revolution hat zu einer zuvor für undenkbar gehaltenen Beschleunigung technischer Innovationen in allen Produktionsbereichen, Informations- und Kommunikationssystemen geführt. Die kulturellen, rechtlichen und sozialen Anpassungszwänge sind schwer zu bewältigen. Die Theorie vom cultural lag hat also durchaus ihre Berechtigung, zumal wenn man sie ganz generell auf den Tatbestand bezieht, dass sich nicht alle gesellschaftlichen Bereiche im Gleichmaß des technisch vorgegebenen Fortschritts bewegen.
Die Bewertung, wie fortschrittlich oder rückschrittlich ein Bereich im Hinblick auf bestimmte Entwicklungen ist – z. B. Schule und Ausbildung in Bezug auf die neuen Strukturen der Netzwerkgesellschaft (Castells 2004) – ist politisch kontrovers. Eine Anmerkung von Ogburn sei in Erinnerung gerufen: »In der großen Perspektive der Geschichte sind allerdings Verspätungen nicht erkennbar, weil sie aufgeholt worden sind. Sichtbare Phänomene sind sie hauptsächlich in der Gegenwart« (Ogburn 1967 : 338).
Eigentlich sind alle soziologischen Theorien seit Auguste Comte (1798–1857), auf den nicht nur der Begriff der Soziologie zurückgeht, sondern auch die Frage nach Statik und Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung sowie Theorien des sozialen Wandels. Das gilt für Karl Marx und Herbert Spencer (1820–1903) ebenso wie für Émile Durkheim oder Max Weber. In dieser Perspektive lassen sich folgende Ansätze unterscheiden (vgl. Dreitzel 1967, Zapf 1984, Jaeger/Meyer 2003, Scheuch 2003):
Evolutionistische (Herbert Spencer) und neo-evolutionistische (Niklas Luhmann),
strukturfunktionalistische und systemtheoretische (Talcott Parsons, Niklas Luhmann),
marxistische und neo-marxistische (Pierre Bourdieu),
Theorien der sozialen Mobilisierung, der gesellschaftlichen Transformation und der Modernisierung (Karl W. Deutsch, Daniel Lerner, Wolfgang Zapf),
mikrosoziale Theorien der Veränderung von Wert- und Normensystemen (George C. Homans).
In allen Theorien über die Änderung der Sozialstruktur bzw. einzelner Bereiche werden Fragen nach den »eigentlichen« Ursachen gestellt. Wie hervorgehoben, spielen hierbei Technik und Wissenschaft und damit die verschiedenen Entwicklungsphasen der Industriellen Revolution eine große Rolle. Aber auch politische Ideologien oder fundamentalistische Religionen können ein dominanter Faktor sozialer und kultureller Veränderungen sein.
Читать дальше