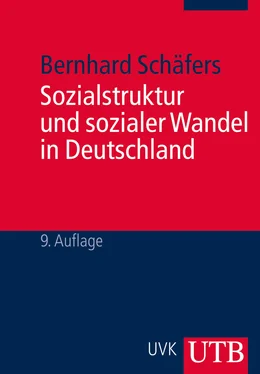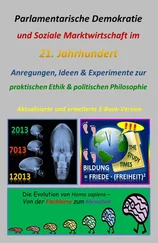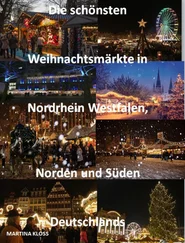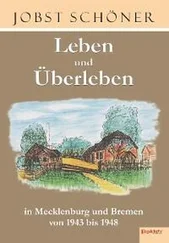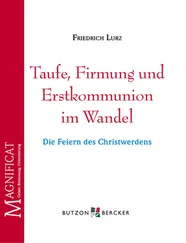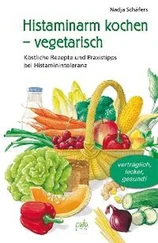Kapitel III
Vereinigungsprozess. Seitherige Entwicklung
Kapitel IV
Bevölkerungsstruktur. Wanderungen. Ausländer und Integration
Kapitel V
Familie, Ehe und Lebensgemeinschaften
Kapitel VI
Elemente des kulturellen Systems: Bildung, Religion, Netzwerke und Medienkultur
Kapitel VII
Struktur und Wandel des politischen Systems
Kapitel VIII
Grundlagen und Wandel des Wirtschaftssystems
Kapitel IX
Struktur und Wandel des Sozialstaats
Kapitel X
Soziale Ungleichheit. Wandel der Klassen- und Schichtungsstruktur
Kapitel XI
Wandel der Siedlungsstruktur, Städte und Wohnverhältnisse
Kapitel XII
Deutschland in Europa
Sachregister
* Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis findet sich vor dem jeweiligen Kapitel
Nr. Inhalt der Tabellen
1 Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 1871–2009 in Mio.
2 Einwohner der Länder/Stadtstaaten in Mio. 2009; Größe in qkm
3 Entwicklung der Altersstruktur. Jugend- und Altenquotienten
4 Ausländische Arbeitnehmer nach ausgewählten Herkunftsländern
5 Ausländische Wohnbevölkerung am 31.12.2010
6 Personen je Haushalt nach Gemeindegröße 2010
7 Durchschnittliche Haushaltsgrößen/Anteil der Einpersonenhaushalte 2010
8 Lebensformen der Bevölkerung
9 Familien mit Kindern unter 18 Jahren 1996 und 2010
10 Erwerbsquoten von Müttern und Vätern 2009
11 Kinder unter 3 bzw. 6 Jahren 2010 in Kindertagesbetreuung
12 Austritte aus der evangelischen und der katholischen Kirche
13 Internetaktivitäten im Jahr 2010
14 Mitgliederentwicklung bei SPD und CDU 1950–2007
15 Mitgliedschaft bei CSU, FDP, Die Grünen, Die Linke 2009
16 Wahlen zum deutschen Bundestag seit 1998
17 Bundestagswahl/Zweitstimmen 2009 nach Berufsgruppen
18 Bevölkerung und Struktur des Arbeitsmarktes 1991–2010
19 Erwerbstätige nach Stellung im Beruf 1950–2010
20 Berufliche Stellung von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund
21 Anteile der Erwerbstätigen in den Produktionssektoren seit 1950
22 Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum BIP
23 Entwicklung der Arbeiterschaft 1882–2010
24 Anteile der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen an den Erwerbspersonen 1881–2010
25 Registrierte Arbeitslose seit 1950
26 Frauenanteile in Spitzenpositionen verschiedener Institutionen
27 Schichtung der Bevölkerung nach relativen Einkommenspositionen
28 Betroffenheit von Armut nach verschiedenen Kriterien
29 Hartz IV-Empfänger mit Kindern in den Bundesländern
30 Subjektive Schichtzugehörigkeit 1990 und 2010
31 Städtewachstum in der Hochindustrialisierungsphase
32 Zahl der Gemeinden über 20 Tsd. Einwohner
33 Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes seit 1950
34 Einteilung des Bundesgebietes in siedlungsstrukturelle Typen
35 Wohnqualität in einigen europäischen Ländern
36 Museumsarten und Zahl der Besuche im Jahr 2009
37 Fläche und Bevölkerung in den 27 EU-Staaten im Jahr 2010
38 Personalbestand der EU-Organe im Jahr 2011
Verzeichnis der Abbildungen
Nr. Inhalt der Abbildungen
1 Altersaufbau und Migrationshintergrund der Bevölkerung
2 Zu- und Fortzüge in Deutschland 1994 bis 2000
3 Das Bildungswesen in Deutschland
4 Drei Säulen des Systems sozialer Sicherheit
5 Haushalte mit Bezug von Wohngeld
Kapitel I
Gesellschaft, Sozialstruktur und sozialer Wandel
1.Begriffe. Empirische Grundlagen
1.1 Gesellschaft – Vergesellschaftung – Vergemeinschaftung
1.2 Gesellschaft im soziologischen Verständnis
1.3 Sozialstruktur und Sozialstrukturanalyse
1.4 Empirische Grundlagen
2.Theoretische Ansätze der Sozialstrukturanalyse
3.Sachdominanz, Raum und Zeit als Elemente der Sozialstruktur
4.Theorien und Trends des sozialen Wandels
4.1 Definition und theoretische Ansätze
4.2 Theorie der gesellschaftlichen Mobilisierung und Modernisierung
4.3 Sozialer Wandel im Strukturfunktionalismus
4.4 Kultur und Wertideen als Quellen des Wandels
5.Globalisierung als Quelle des Strukturwandels
Literatur
1. Begriffe. Empirische Grundlagen
1.1 Gesellschaft – Vergesellschaftung – Vergemeinschaftung
Beim Begriff Gesellschaft *besteht die Gefahr, ihn vorschnell zu objektivieren und als real leicht nachweisbar anzusehen. Bereits Georg Simmel (1858–1918) hatte davor gewarnt. Seinem Werk »Soziologie« stellte er einen Exkurs voran: »Wie ist Gesellschaft möglich«? (1908/1968 : 21–30) **. Gesellschaft ist nach Simmel nicht nur die Summe der vergesellschafteten Individuen, von den sozialen Gruppen bis zu komplexen Organisationen und dem Staat, sondern zugleich die Summe aller möglichen Wechselwirkungen, die daraus entstehen können.
Gesellschaft ist auch im Alltagsverständnis ein vielschichtiger Begriff, der von der Tischgesellschaft bis zur Reisegesellschaft, von der Gesellschaft der Musikfreunde bis zur Aktiengesellschaft reicht. Die Verbundenheit oft sehr unterschiedlicher Personen mit einem bestimmten Zweck, ob kurz- oder langfristig, ist entscheidend. Das besagt auch der Wortursprung. Danach bedeutet Gesellschaft »den Inbegriff räumlich vereint lebender oder vorübergehend auf einem Raum vereinter Personen«, so der Soziologe und Begründer der Schichtungssoziologie Theodor Geiger (1891–1952) im ersten deutschsprachigen »Handwörterbuch der Soziologie« (1931/1957).
Für die Geschichte des Gesellschaftsbegriffs ist bis heute die griechisch-römische Tradition wegweisend (einen Überblick gibt Riedel 1975). In allen Etappen der europäisch-abendländischen Geschichte blieb bewusst, was Platon (428–348) und Aristoteles (384–322) in ihren Werken über Staat und Gesellschaft ausführten. Der Mensch »ist von Natur ein nach der staatlichen Gemeinschaft strebendes Wesen« (Aristoteles, Politik, 1278 b), aber erst die Polis, der griechische Stadtstaat, lässt seine Anlagen im Zusammenspiel mit den Aktivitäten anderer Menschen zur Entfaltung kommen. Die Bürger sind zur Selbstverwaltung aufgerufen. Der Staat sorgt vor allem für den Schutz der Bürger nach innen und außen in einem territorial klar definierten Gemeinwesen.
Diese Gemeinwesen sind heute komplexe, nationalstaatlich verfasste Gesellschaften. In soziologischer Perspektive sind zwei Begriffe hilfreich: Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung. In der Vielfalt ihrer Formen und in ihren Wechselwirkungen spiegelt sich die Lebenswirklichkeit der vergesellschafteten Individuen. Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung sind Begriffe, die der wohl bekannteste deutsche Soziologe, Max Weber (1864–1920), im Anschluss an ein frühes Hauptwerk der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies’ »Gemeinschaft und Gesellschaft« (zuerst 1887), bildete.
»›Vergemeinschaftung‹ soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns (…) auf subjektiv gefühlter (affektueller oder traditionaler) Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht. ›Vergesellschaftung‹ soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf rational (wert- oder zweckrational) motiviertem Interessenausgleich oder auf ebenso motivierter Interessenverbindung besteht« (Weber 2002 : 694 f.).
Читать дальше