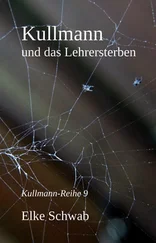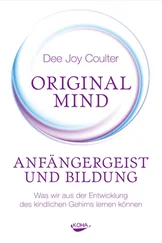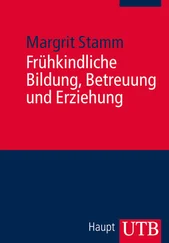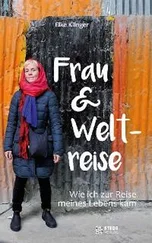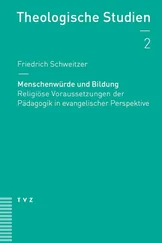Fragen und Aufgaben
Fragen und Aufgaben
1 Beratungsanfrage an Montanari (2016):„Mein Mann und ich kommen gebürtig aus Bulgarien und leben seit 14 Jahren in Deutschland. Nun kam unser Sohn Alexander zur Welt. Er ist jetzt 4 Monate alt. Ich hatte mir vorgenommen, mit ihm Deutsch zu sprechen und mein Mann Bulgarisch. Allerdings wurde mir gesagt, ich soll das nicht machen, da Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Ich mache keine Fehler beim Sprechen, habe aber eine slawische Aussprache.Zu Hause sprechen wir vorwiegend Bulgarisch, ab und zu leider sogar gemischt Deutsch-Bulgarisch-Griechisch. (Ich weiß, dass das für den Kleinen nicht gut sein kann, deshalb versuchen wir es jetzt schon zu vermeiden.)Ich habe Sprachwissenschaften studiert und würde ganz gern meinem Sohn mehrere Sprachen beibringen wollen.In Bulgarien sind die Großeltern.Wir leben in Deutschland.Dazu haben wir ein Haus in Griechenland.Und Englisch muss heutzutage sein.Ich möchte aber das Kind nicht überfordern, deshalb wäre zum Anfang super, wenn es Deutsch und Bulgarisch lernt.Wie machen wir das am besten?Darf ich zu ihm Deutsch sprechen, wenn das nicht meine Muttersprache ist?Wann fangen wir am besten an?“Diskutieren Sie, wie Sie hier beraten würden. Berücksichtigen Sie dabei folgende Aussagen:
Wenn wir sprechen, befinden wir uns immer in „einem Dialog von Sprachen“ (Bakhtin 1979:186).
„Translanguaging is the discursive norm in bilingual families and communities. For example, the only way to communicate in bilingual/multilingual family events is to translanguage“ (García/Li Wei 2014:23).
B. Mehrsprachigkeit und Bildung in der KiTa
Julie A. Panagiotopoulou
2 Translanguaging: Mehr- und Quersprachigkeit im Erwerb und Gebrauch
Die vierjährige Lena hört zu, während ihre Erzieherin spricht; plötzlich stellt sie laut fest: „Hanna sagt auch ‚ isch‘ – wie ich!“
Die fünfjährigen Max und Lena sind gut befreundet und spielen oft zusammen. Am Frühstückstisch sitze ich mit einer Gruppe von Kindern neben Max, der plötzlich auf Lena zeigt und kommentiert: „Sie spricht mit uns Spanisch! Wir verstehen nicht, was sie sagt“. „Ich spreche nicht Spanisch“, erwidert Lena (lachend), „ich spreche Griechisch!“ „Ja“, setzt Max fort und schaut sie dabei an, „wir verstehen nicht, was du sagst“. Lena erklärt ihm in beruhigendem Ton „ich spreche mit euch Griechisch, damit ihr Griechisch lernt!“ und an mich gewandt mit etwas lauter Stimme: „ Ich spreche zwei Sprachen ganz: ‚germanika ke elinika‘[Deutsch und Griechisch] und Englisch lerne ich noch in der Schule!“ Kurz danach teilt sie der Gruppe mit: „Nein, ich spreche drei Sprachen: Deutsch, Griechisch und Kölsch!“
(Ausschnitte aus Beobachtungen im KiTa-Alltag, aus der Fallstudie ‚Lena‘; Protokoll: Panagiotopoulou)
2.1 Sprachmischung: zur translingualen Praxis mehrsprachiger Kinder
Die vorangestellten Beispiele ethnographischer Beobachtungen im Alltag einer Kindertageseinrichtung in Nordrhein-Westfalen sollen exemplarisch verdeutlichen, wie mehrsprachig lebende Kinder mit verschiedenen Sprachen und Varietäten (Regiolekten, Dialekten; siehe dazu auch Kapitel 1) in Berührung kommen und sie parallel, aber auch ineinander bzw. ‚gemischt‘ gebrauchen. In deutschsprachigen Fallstudien der letzten Jahre werden entsprechende Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen dokumentiert, mit deren Hilfe verdeutlicht werden kann, wie im familialen Alltag sprachenübergreifendkommuniziert wird (vgl. Tracy 2008:102). Insbesondere wenn Eltern systematisch ihre Familiensprachen und die Umgebungssprache(n) gemischt einsetzen, produzieren ihre Kinder logische „Mischäußerungen“ (ebd.:107). Das Phänomen der „Sprachmischung gehört zur Natur der Bilingualität“ (Schneider 2015:36), und zwar sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern:
Sie [die Sprachmischung] zeichnet erwachsene fließende Sprecher und Sprecherinnen von zwei Sprachen genauso aus wie Kinder, die gerade im Begriff sind, zwei Sprachen zu erwerben. (ebd.:37)
„Kinder mischen nicht mehr oder schlechter als Erwachsene es tun“ (Müller, Kupisch, Schmitz, Cantone 2011:200) und sind außerdem sehr wohl in der Lage, auf den translingualen Sprachgebrauchzu verzichten, um je nach Situation und Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin monolingual zu handeln. Dies zeigt, dass Mehrsprachige sehr früh damit beginnen, ihre sprachliche Praxis (inklusive Sprachwahl) bewusst zu gestalten (vgl. auch Riehl 2014:85; Panagiotopoulou 2016:14). Darüber hinaus sind mehrsprachige Kinder mit der Zeit auch in der Lage, ihr komplexes linguistisches Repertoire verschiedenen Sprachen und Sprachvarietäten zuzuordnen.
Die vorangestellten Protokollausschnitte zeigen exemplarisch, wie Lena im KiTa-Alltag sowie in Interaktion mit Kindern und Erwachsenen mehr- und quersprachig handelt. Dabei verwendet sie nicht nur zwei Sprachen, sondern auch Varietäten (teilweise gemischt). Das erste Beispiel deutet darauf hin, dass die vierjährige Lena über ihre eigene sowie über die Sprachpraxis ihrer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner reflektiert: hier am Beispiel der Aussprache „ich“ und „isch“. Den im KiTa-Alltag verwendeten Regiolekt setzen die Kinder in der Tat hauptsächlich in Interaktion mit ihrer Erzieherin Hanna ein. Das zweite Beispiel deutet darauf hin, dass Lena, wahrscheinlich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit ihren zweisprachigen Eltern, ihre deutschsprechenden Freundinnen und Freunde bewusst auf Griechisch anspricht, damit diese ebenfalls zweisprachig werden. Dass Lena mit der deutsch-griechischsprechenden Beobachterin nicht nur monolingual deutsch oder griechisch, sondern regelmäßig auch translingual deutsch-griechisch kommuniziert, bestätigt die These, dass Kinder in der jeweiligen Interaktion das linguistische Repertoire ihrer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner berücksichtigen und ihre eigene Sprachpraxis entsprechend anpassen. Mit anderen Worten: Der weit verbreitete Mythos „Children raised bilingual will always mix their languages“ (Grosjean 2010:197) lässt sich in der Praxis nicht bestätigen. Vielmehr hängt der mono- oder translinguale Sprachgebrauchvon Kindern mit pragmatischen Bedingungen innerhalb von konkreten Interaktionen und – mit zunehmendem Alter – auch mit bewussten Entscheidungen zusammen: Kinder mischen folglich ihre Sprachen in der Regel nur dann, wenn sie mit Personen interagieren, die über ein vergleichbares Sprachenrepertoire verfügen.
Insbesondere unter den Bedingungen der Migration greifen bereits junge Kinder in der Regel gleichzeitig auf mehrere (Landes-)Sprachen und deren Varietäten zurück. Der Sprachgebrauch migrationsbedingt mehrsprachig lebender Kinder wird allerdings im öffentlichen Diskurs problematisiert, als Halbsprachigkeitabgewertet, oder im Hinblick auf die Sprachpraxis einer konkreten Minderheit in Deutschland zum Beispiel als „Türkendeutsch“ oder als „Kanak Sprak“ karikiert1. Während die translinguale Praxis Erwachsener sogar als besondere Kompetenz anerkannt wird, wird „die Sprachmischung in der frühkindlichen Zweisprachigkeit“ (Schneider 2015:37) eher negativ betrachtet:
Das vermeintlich unsystematische und gegen alle Regeln verstoßende Mischen der Kinder wird als nachteilige Auswirkung des bilingualen Erstspracherwerbs interpretiert. In der neueren linguistischen Forschung wird Sprachmischung hingegen als nützliche Strategie gesehen, mit deren Hilfe sich bilinguale Kinder und Erwachsene effektiver ausdrücken können.
Читать дальше
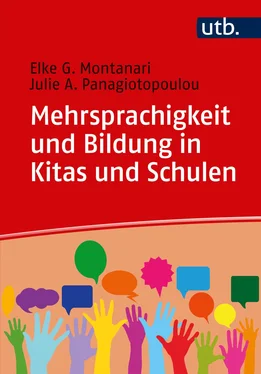
 Fragen und Aufgaben
Fragen und Aufgaben