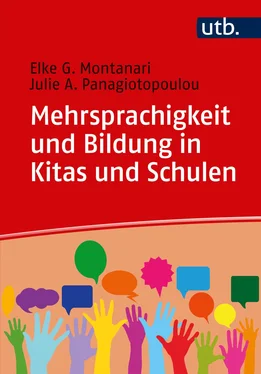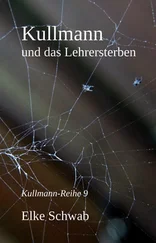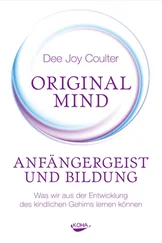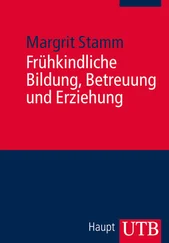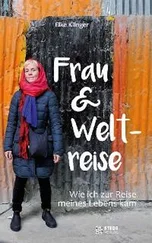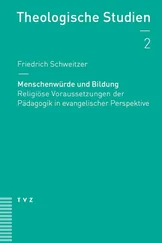1.3 Heteroglossie als individuelle und institutionelle Praxis: mehrsprachiges Wissen, Handeln und Multikompetenz
„Heteroglossia“ (auf Deutsch: Heteroglossie) und „translanguaging“ sind – laut García und Li Wei (2014) – zwei konzeptionell verwandte Begriffe, da beide „the fluid language practices of speakers“ beschreiben, wobei „heteroglossia“ als ein Oberbegriff verstanden wird: „The Bakhtinian concept of heteroglossia, […] serves as an umbrella term for all of these practices, including that of translanguaging“ (García/Li Wei 2014:36). Den Begriff Heteroglossia hat der Literatur- und Sprachwissenschaftler Mikhail Bakhtin (auch geschrieben: Michail Bachtin) in den 1930er-Jahren eingeführt, um zu verdeutlichen, dass Sprachen, wenn sie aus der Perspektive der Sprecherinnen und Sprecher betrachtet werden, keine in sich geschlossenen Systeme sind. Damit soll deutlich gemacht werden, dass eine „einheitliche Sprache“ nicht mit der „lebendigen Sprache“ oder der sprachlichen Realität der Sprecherinnen und Sprecher übereinstimmt (Busch 2015:50). Laut Bakhtin befinden sich nämlich alle Menschen immer in „einem Dialog von Sprachen“ (Bakhtin 1979:186, zit. nach Busch 2015:50f.). Damit ist u.a. „das Bündel an Varietäten, Registern oder Jargons gemeint, das man traditionellerweise mit dem Begriff ‚innersprachliche Mehrsprachigkeit‘ fasst“ (Busch ebd.).
Wie kann nun diese Vielsprachigkeit konzeptionell gefasst werden? In der Mehrsprachigkeitsdiskussion zeigen sich aktuell unterschiedliche Sichtweisen auf die Frage der Einzelsprachen und ihrer Realität. Einerseits gibt es klar abgrenzbare Systematiken von Sprachen: Es liegen Sprachbeschreibungen von Sprache X und Sprache Y vor, wir kennen Gemeinsamkeiten und können Unterschiede klar benennen, z.B. in der Deklination, Morphologie, Wortstellung. Des Weiteren können wir, wenngleich in unterschiedlichen theoretischen Paradigmen, diese systematisieren, untersuchen, testen und unterrichten. All dies ist in vielen Grammatiken und Wörterbüchern aufbereitet und für den Gebrauch operationalisiert, und, wenn es sein muss, sogar als Reisewörterbuch in Taschenbuchgröße erhältlich. Allerdings sind hiervon viele Sprachen nicht erfasst, deren Bedeutung insbesondere für Handel oder Tourismus nicht groß ist, deren Sprecherinnen und Sprecher nur eine relativ kleine Gruppe darstellen, oder Sprachen und Sprachvarietäten, die verboten oder unterdrückt sind.
Während also ein Wörterbuch oder eine Lernergrammatik Sprachen als System begreifbar und lernbar macht, ist die Abgrenzung einer Sprache von einer anderen tatsächlich nicht (ausschließlich) sprachwissenschaftlich zu beantworten. Hierbei kommen neben linguistischen Abgrenzungen wie z.B. der typologischen Distanz, die besondere Lexik sowie gesellschaftspolitische Fragen zum Tragen. Diese hängen auch mit der Frage zusammen, welche Sprache(n) einer Nation zugeordnet werden. Luxemburgisch ist ein Beispiel dafür, wie sich ein Dialekt zur Nationalsprache entwickeln kann und „wie die politische Eigenständigkeit eines Landes den Status einer Sprache beeinflussen kann“ (Marten 2016:166). Sprachen sind selbst veränderlich: Wörter werden aus anderen Idiomen übernommen, Sprachen werden gemischt, Menschen transferieren Sprachwissen von einer Sprache in eine andere und erfinden neue Redewendungen, von denen sie sich aus anderen Sprachen anregen lassen.
Schon aus systematischer Sicht ist die Abgrenzung von Sprachen untereinander und von Sprachen und Dialekten also vielschichtig. Noch schwieriger ist es aber, den Gebrauch zu erfassen, weil dieser veränderlich ist. Die alltägliche Sprachpraxis von Sprecherinnen und Sprechern, Gruppen, Institutionen und Gesellschaften zeigt, dass klare Trennungen von Sprachen im Gebrauch oft nicht durchgehalten werden können,
weil mehrere Sprachen gleichzeitig gebraucht werden,
weil Sprachen untereinander und aufeinander wirken, und zwar in vielfältigen Interaktionen, auf gesellschaftlicher, institutioneller und individueller Ebene.
Mehrsprachige Sprecherinnen und Sprecher verfügen über Wissen um alle ihre Sprachen. Dieses Wissen interagiert und kann nicht in additiven Vorstellungen als multiple Einsprachigkeit erfasst werden: Mehrsprachigkeit ist mehr und etwas anderes als eine Multiplikation Einsprachiger (Grosjean 1989). Dies zeigt sich unter anderem in einem für Mehrsprachige charakteristischen Sprachgebrauch. So ist das Wechseln zwischen Sprachen, das Code-Switching (Myers-Scotton, Jake, Gross 2002), typisch für viele Mehrsprachige und zeigt die Fähigkeit, mehrere Sprachen miteinander in eine regelkonforme Form zu bringen. Es ist weder ungeregelt noch willkürlich, sondern ein Anzeichen hoher mehrsprachiger Bewusstheit (Özdil 2010). Der gemischte Gebrauch mehrerer Sprachen in sprachlichen Handlungen (zum Phänomen Sprachmischung siehe auch Kapitel 2) erhöht die Möglichkeiten, sich auszudrücken, und ist in mehrsprachigen Gruppen schon in der frühen Kindheit (García/Li Wei 2014:85) und im jungen Schulalter häufig anzutreffen (Li Wei 2014). Ein multikompetenter Ansatz erfasst das Wissen einer Sprecherin oder eines Sprechers über seine Sprachen und deren Einbezug in den Sprachgebrauch in einer ganzheitlichen Sicht als die Fähigkeit, in mehreren Sprachen angemessen handeln zu können (Li Wei 2011). Vor diesem Hintergrund ist also zu fragen, ob es nicht sinnvoller ist, die Kompetenz im Umgang mit Sprachenvielfalt und Heteroglossie zu diskutieren und zu fördern, anstatt die Idee von klar abgrenzbaren Sprachen zu verfolgen. Denn unter Berücksichtigung der Sprachen, die alle Kinder und Jugendlichen im Rahmen ihrer Bildungsbiographie erwerben, sind alle Menschen als potentielle oder angehende Mehrsprachigezu betrachten (vgl. García/Kleifgen 2010:3). Zwei- und Mehrsprachige verfügen über ein komplexes, multilinguales Repertoire an Praktiken, das es ihnen ermöglicht, flexibel über Sprachen hinweg zu kommunizieren. Ihre beobachtbaren pluri- oder multilingualen Praktiken werden ressourcenorientiert als Multikompetenzerfasst:
A multicompetence approach enables us to investigate the structural, cognitive, and sociocultural dimensions of codeswitching in an integrated and holistic way. It also has the added value of revealing the multilingual language users’ creativity and criticality that manifest in their multilingual practices.
(Li Wei 2011:374)
Multicompetence, i.e., the knowledge of more than one language in the mind, is part of the individual capacity of a person and develops in interaction with his or her social or educational environment. … A multicompetent person is therefore an individual with knowledge of an extended and integrated linguistic repertoire who is able to use the appropriate linguistic variety for the appropriate occasion.
(Franceschini 2011:351)
Das Konzept der Multikompetenz erweitert die Ebenen der Mehrsprachigkeit von Gesellschaft, Institution und Individuum um den Aspekt der Interaktion. Unter Interaktion sollen hier sowohl das intraindividuelle Geschehen auf mentaler Ebene (Cook 2016) als auch das Zurückgreifen auf ein mehrsprachiges Repertoire in sprachlichen Handlungen verstanden werden (Franceschini 2011). Beides sind multiple sprachliche Kompetenzen. Ein Repertoire ist dabei nicht als stabil und geographisch bestimmt zu verstehen, sondern als veränderlicher und in den sozialen Praxen verankerter vielsprachiger Sprachgebrauch anzusehen (Busch 2014). Damit verwenden Mehrsprachige ihre Sprachen als Ressource für erfolgreiche Kommunikation und gestalten ihre Identitäten in mehrsprachigen Handlungen (Cenoz/Gorter 2014). Ein an Multikompetenz orientierter Ansatz bezieht ein, wie sich das Wissen über mehrere Sprachen in den verschiedenen Interaktionen entwickelt (Cook/Li Wei 2016).
So zeigt sich als Fazit, dass einerseits aus struktureller Sicht Sprachen von anderen abgegrenzt und verstanden werden können. Die Konzepte Heteroglossie und Multikompetenz zielen auf eine Sprachpraxis ab, in der Sprecherinnen und Sprecher sprachliche Mittel aus einem Repertoire für sich einsetzen, das über die einzelne Sprache hinausgreift.
Читать дальше